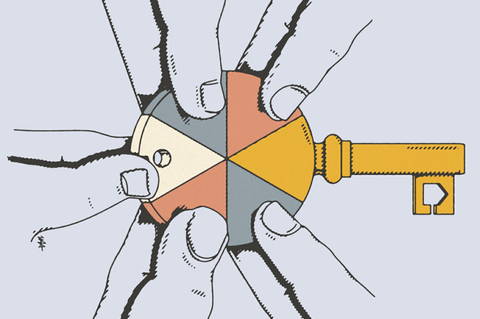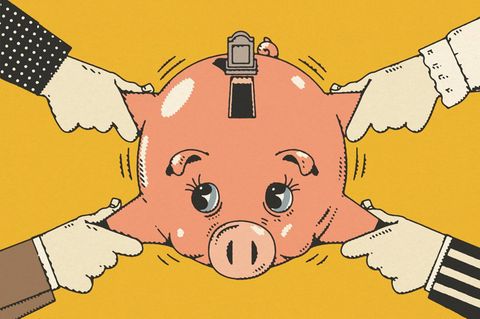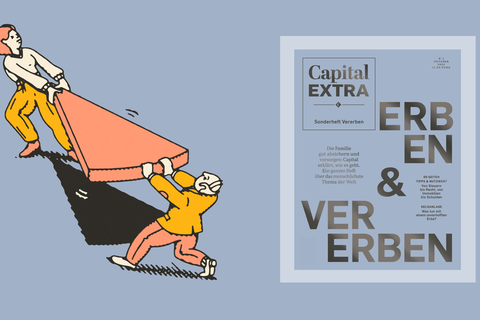Inhaltsverzeichnis
Der Immobilienmarkt in Maxvorstadt
Kaufpreise Bestand
Einfamilienhäuser aus dem Bestand (älter als zwei Jahre) mit normaler Ausstattung kosten zurzeit zwischen 4000 Euro/qm und 18500 Euro/qm. Der Median liegt bei 11600 Euro/qm. Bei Eigentumswohnungen aus dem Bestand (älter als zwei Jahre) liegen die Preise zwischen 7400 Euro/qm und 17900 Euro/qm. Der Median liegt bei 11200 Euro/qm.
Die Kaufpreise für Einfamilienhäuser aus dem Bestand (älter als zwei Jahre) sind in den vergangenen zwölf Monaten um 3,21 Prozent gestiegen. Die Kaufpreise für Bestandswohnungen sind in den vergangenen zwölf Monaten um 5,88 Prozent gesunken.
Kaufpreise Neubau
Bei Neubauhäusern (nicht älter als zwei Jahre) liegen die Angebotspreise zwischen 0 Euro/qm und 0 Euro/qm. Der Median beträgt 0 Euro/qm. Für Neubauwohnungen werden in vergleichbaren Lagen Kaufpreise zwischen 6500 Euro/qm und 22900 Euro/qm verlangt. Der Median beträgt hier 18700 Euro/qm.
Die Kaufpreise für Neubauten (nicht älter als zwei Jahre) sind im letzten Jahr um 0,00 Prozent gesunken. Die Kaufpreise für Neubauwohnungen sind im letzten Jahr um 6,57 Prozent gestiegen.
Mietpreise
Die Mieten für Wohnungen aus dem Bestand liegen zwischen 13,30 Euro/qm und 40,20 Euro/qm. Der Median beträgt 23,45 Euro/qm. Die Mietpreise für Bestandswohnungen sind in den vergangenen zwölf Monaten um 2,63 Prozent gestiegen.
Bei Neubauten in vergleichbaren Lagen gehen die Mietpreise von 17,70 Euro/qm bis 45,10 Euro/qm. Der Median liegt bei 28,80 Euro/qm. Die Mietpreise für Neubauwohnungen sind im letzten Jahr um 6,86 Prozent gestiegen.
Mietrendite
Die Bruttomietrenditen für Bestandswohnungen liegen bei durchschnittlich 2,50 Prozent. Bei Neubauwohnungen liegen die Bruttomietrenditen im Durchschnitt bei 1,80 Prozent.
Datengrundlage
Stichtag für die Datenerhebung ist der 01.01.2024. Alle Preisangaben beziehen sich im Regelfall auf die Angebote der vergangenen zwölf Monate. Um den Markt realistisch abzubilden und Ausreißer zu eliminieren, wurden die oberen und unteren zehn Prozent der Angebotspreise gekappt.
Immobilien- und Mietpreise in München-Maxvorstadt
Karte
Weitere Immobilienpreise in der Umgebung von München-Maxvorstadt
In dieser Region
- München-St. Benno
- München-St. Vinzenz
- München-Marsfeld
- München-Maßmannbergl
- München-St. Paul
- München-Alte Kaserne
- München-Lehel
- München-Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt
- München-Altstadt
- München-Schwabing-Ost
- München-Altstadt - Lehel
- München-Gärtnerplatz
- München-Ludwigsvorstadt-Kliniken
- München-Neuschwabing
- München-Englischer Garten Süd