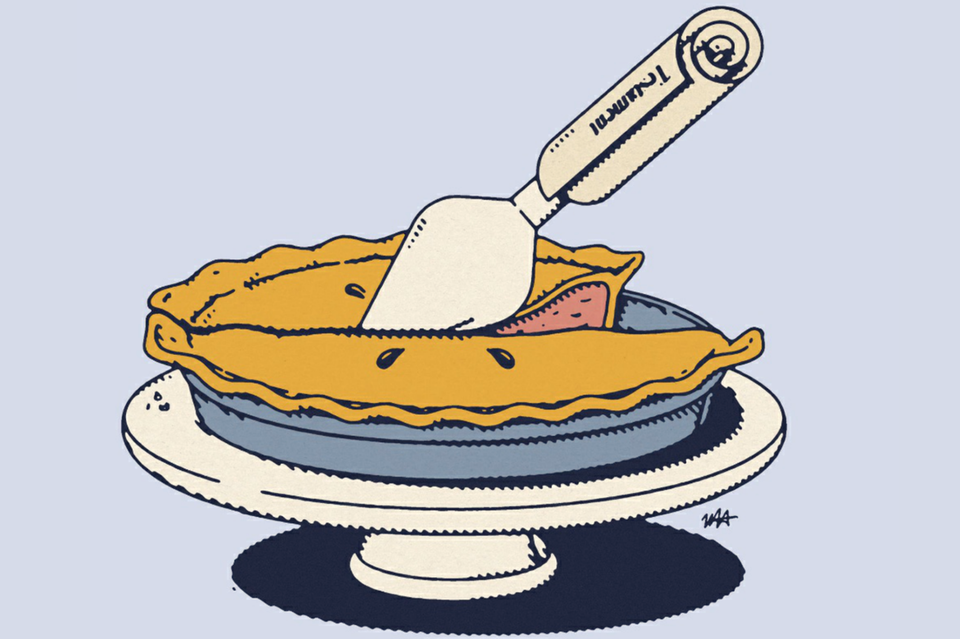Der Physiker und Bildungsforscher Andreas Schleicher leitet die Bildungsdirektion bei der Industrieländerorganisation OECD. Vor fast 25 Jahren konzipierte er dort die berühmte Pisa-Studie, die die Schulsysteme der verschiedenen Länder miteinander vergleicht. In der laufenden Untersuchung hat Schleicher bei Pisa eine Neuorientierung durchgesetzt: Künftig richtet die Studie ihren Blick besonders auf jene Bildungsinhalte, die die OECD als zukunftsentscheidend sieht: Kreativität, Entrepreneurship, Offenheit, Empathie.
Capital: Früher haben Sie bei der Pisa-Studie untersucht, ob unsere Kinder rechnen und schreiben können. Nun wollen Sie schauen, ob sie kreativ sind. Warum?
ANDREAS SCHLEICHER: Rechnen und Schreiben sind sicherlich wichtig. Aber in Zeiten der künstlichen Intelligenz wird entscheidend, dass wir Dinge können, die Computer nicht so gut können. Fähigkeiten, die künstliche Intelligenz ergänzen. Am wichtigsten sind da Kreativität, das Vermögen, komplexe Lösungen zu finden, lateral zu denken, also abseits des Mainstream. Ebenso ist es wichtig, Entscheidungen in komplexen Räumen treffen zu können. Das sind heute Schlüsselfähigkeiten, die mindestens genauso wichtig sind wie Mathematik- oder Lesekompetenz.
Und diese Fähigkeiten wollen Sie jetzt messen?
In der nächsten Pisa-Untersuchung, die 2021 veröffentlicht wird, wird dieser Aspekt eine wichtige Rolle spielen.
Wie untersuchen Sie denn die Fähigkeit eines Schulsystems in Sachen kreatives Lernen?
Die Schüler müssen zum Beispiel am Rechner eine Werbung konzipieren und dann in verschiedenen Formen umsetzen. Im ersten Schritt müssen sie kreativ Lösungen finden. Zum zweiten sollen sie selber die Originalität ihrer Lösungen bewerten. Auch das ist wichtig. Kreativität heißt nicht einfach Ideen zu produzieren, sondern auch systematisch zu Innovationen zu kommen, also zu bewerten, zu analysieren. Das sind vier, fünf Schritte, die sie durchführen und daraus können wir dann Schlussfolgerungen ziehen.
Und am Ende gibt es ein Pisa-Ranking nach Kreativität?
Wir haben heute gut etablierte Verfahren, um Kreativität zu messen. Dass das international machbar ist, das müssen wir jetzt zeigen. Es ist das erste Mal, dass es einen internationalen Test dazu gibt.
Bislang nehmen wir an der Schule noch sehr oft eindimensional Wissen auf. Ist in diesen Strukturen überhaupt jenes kreative Lernen denkbar, von dem Sie sprechen?
Wir können auch in einem Fach wie Mathematik Räume schaffen, um sehr kreativ zu lernen und zu unterrichten. Es wird aber dann schwierig, wenn Schüler nur passive Konsumenten sind. Die Vermittlung von Lernstoff ist heute nicht mehr das Wesentliche. Es geht nicht mehr darum, was wir wissen – Google weiß alles. Es geht darum, was wir mit unserem Wissen tun können. Dafür brauchen Kinder in der Schule Raum. Wenn wir Menschen bilden wollen, die kreativ sind, dann brauchen sie Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren. Wenn man Dinge ausprobiert, dann macht man Fehler und entscheidend ist, wie gut ein Bildungssystem darin ist, Fehler zu tolerieren, Menschen zu helfen, aus Fehlern zu lernen. Das wird darüber entscheiden, wie kreativ nachher die Schüler sind.
Wie sähe denn zum Beispiel solch ein Matheunterricht aus?
Die Frage ist, wie wir Mathematik kreativer vermitteln können. Warum etwa wenden wir in Deutschland in der 11. oder 12. Klasse so viel Zeit auf, um Trigonometrie zu lehren? Ist das der Kern der Mathematik? Nein. Der Grund, warum wir das heute unterrichten ist, dass wir das vor 400 Jahren gebraucht haben, um die Größe unserer Felder zu messen. Es ist im Grunde tote Wissenschaft. Solche Überbleibsel aus einer längst vergangenen Zeit gibt es viele. Im Bereich der Mathematik kreativ zu denken, heißt etwa mit probabilistischen Zusammenhängen zu arbeiten, also mit Wahrscheinlichkeitsaussagen und -algorithmen. Das ist ja ein wichtiges Thema der heutigen Welt, dass sich oft nicht mehr klar zwischen richtig und falsch entscheiden lässt.
Welche erfolgreichen Beispiele gibt es für kreatives Lernen?
Die Digitalisierung schafft da viele Möglichkeiten. Sie brauchen zum Beispiel in den Naturwissenschaften nicht mehr abstrakt über Experimente zu sprechen, Sie können sie in einem virtuellen Laboratorium durchführen. Die neuen Möglichkeiten stellen natürlich ganz andere Anforderungen an die Lehrpersonen, das muss man auch sehen. Es ist sehr viel leichter, vorgefertigten Stoff zu vermitteln, als Umfelder zu schaffen, in denen Schüler kreativ arbeiten.
Welche Erkenntnisse und Vermutungen haben Sie schon über das deutsche Bildungssystem?
Deutsche Schüler kommen relativ gut mit Aufgaben zurecht, bei denen sie Fachwissen reproduzieren müssen. Das gilt besonders in Biologie, Chemie, Physik. Die Schüler haben aber große Schwierigkeiten, wenn sie zeigen müssen: Ich kann wie ein Naturwissenschaftler denken. Ich kann selber ein Experiment konzipieren. Ich kann Ursache und Wirkung erkennen. Und das sind die entscheidenden Fähigkeiten. Wenn wir nicht denken lernen wie Naturwissenschaftler, dann nützt uns auch Google nicht. Da liegen in Deutschland große Herausforderungen, das sehen wir schon an den heutigen Daten. Wie sich das auf die Kreativität der Schüler im Vergleich zu anderen auswirkt: Das werden wir sehen, wenn wir die Testergebnisse haben.
Es reicht also künftig nicht mehr, die richtigen Antworten auf Prüfungsfragen zu geben, um bei Pisa gut auszusehen?
Wir müssen lernen, dass es heute darum geht, die richtigen Fragen zu stellen, nicht die richtigen Antworten zu geben. Wir sollten nicht nur lehren und lernen, wie Naturwissenschaftler zu denken, sondern auch wie Philosophen, wie Historiker zu denken. Das sind die Dinge, die Schülern in Deutschland schwerfallen.
Die Bildungsdiskussion in Deutschland wurde in den letzten Jahren dominiert von dem Schlagwort Mint, also den Leistungen in Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Dahinter steht die Sorge, dass uns die Ingenieurkompetenzen verloren gehen. Ist die Sorge berechtigt?
Wenn wir hier auf die Schülerleistungen schauen, dann sind die in Deutschland okay. Sie sind nicht bei den Spitzenländern, aber sie liegen deutlich über dem OECD-Durchschnitt. Wenn wir uns aber anschauen, wer von den 15-Jährigen später einmal in diesen technischen und ingenieurwissenschaftlichen Feldern arbeiten möchte, ist Deutschland das absolute Schlusslicht. Es gelingt uns also, in der Schule, Mint-Wissen zu vermitteln. Es gelingt uns aber nicht, Schüler für diese Fächer zu begeistern, gerade die Mädchen. Das zeigt: Einfach mehr Mint-Fächer zu unterrichten, wird das Problem nicht lösen. Wenn junge Menschen nicht sehen, wie Mint-Fächer den eigenen Horizont erweitern, Lebenschancen eröffnen, Karriereperspektiven bieten, dann sind sie tote Schulfächer. Da muss Deutschland sehr viel mehr Gewicht legen auf die sozialen und emotionalen Komponenten, anstatt immer nur zu versuchen, mehr Mint-Wissen zu schaffen.
Was halten Sie zum Beispiel von der Forderung, dass alle Schüler früh Programmieren lernen sollten, am besten schon im Kindergartenalter?
Diese Kompetenzen sind sehr zeitgebunden. Daher ist das kaum dienlich. Was wichtiger zu vermitteln wäre: Data Science. Kann ich mit Informationen umgehen? Wir nennen das im englischen Sprachgebrauch computational thinking. Kann ich mit algorithmischen Denkstrukturen umgehen? Es ist viel zu stark von heute aus gedacht, wenn wir als erstes daran denken, Programmierfähigkeiten zu unterrichten. Wir sind immer besser darin, die Kinder für unsere Vergangenheit zu bilden, als für deren Zukunft.
Ist das ein kulturelles Problem oder ein strukturelles Defizit – haben wir zu viele antiquierte Elemente im Bildungssystem?
Es ist beides. Das kulturelle Problem sollte man nicht unterschätzen. Wir als Eltern sind da manchmal Teil des Problems, nicht der Lösung. Wir werden sehr schnell nervös, wenn unsere Kinder Dinge lernen, die wir nicht gelernt haben. Oder wenn unsere Kinder Dinge nicht mehr lernen, die für uns wichtig waren. Da müssen wir uns selber an die Nase fassen. Gleichzeitig sind die Strukturen in Deutschland sehr industriell ausgerichtet. Wenn wir alle bildungsrelevanten Entscheidungen zusammennehmen, dann werden in Deutschland nur 13 Prozent davon in der Schule getroffen. Das ist etwas mehr als eine von zehn Entscheidungen. In den Niederlanden sind es acht von zehn Entscheidungen. Wir schaffen viel zu wenig Freiräume an der Basis, und erlauben den Lehrkräfte nicht, selber kreativ zu arbeiten. Wir schreiben ihnen hingegen sehr viel vor, wir geben ihnen sehr viel Unterrichtskonzepte vor. Wenn man diese Strukturen mehr an die Basis verlagern würde, dann hätten wir auch mehr Raum für Flexibilität und Dynamik im System.
Nun war eine Reaktion vieler Eltern und Politiken auf die Pisa-Debatte die Forderung nach mehr Autorität, mehr Leistungsbeurteilung und Auslese. Eltern leitet im Zuge der Globalisierung oft die Angst, ob es ihren Kinder später noch besser gehen wird, als ihnen selbst. Wie reagiert man darauf?
Angst ist oft ein schlechter Ratgeber. Angst verleitet uns, die Dinge zu tun, die wir immer am besten beherrscht haben. Angst schränkt unsere Sicht ein. Angst fokussiert uns auf das, was wir bereits können. Und in diesem Fall ist das Gegenteil wichtig. Dass wir uns von den Dingen lösen, die für die Zukunft nicht mehr relevant sind. Im Bildungsbereich gilt: Weniger Dinge in größerer Tiefe vermitteln. Wir haben die Lehrpläne hoffnungslos überfrachtet mit allem möglichen Detailwissen. Und das kommt von der Angst. Das kommt daher, dass wir uns davon leiten lassen, in den Lehrplänen bloß nichts zu vergessen.
Sehen Sie da auch den Grund für die Forderung nach neuen Schulfächern wie Programmieren?
Genau, jeden Tag kommt etwas dazu. Da fordert jemand Unterricht in Umweltkompetenz, dann digitale Kompetenz, dann Finanzwissen. Also, irgendjemandem fällt immer wieder etwas ein. Die Kunst ist aber, weniger Dinge in größerer Tiefe zu unterrichten. Das zeichnet die leistungsfähigsten Bildungssysteme aus.
Jack Ma, der Gründer von Alibaba hat gesagt, man sollte vor allem Musik, Kunst und Sport unterrichten.
Die künstlerischen Fächer haben heute eine ganz entscheidende Bedeutung. Sie ist vielleicht nicht so instrumentell, wie ich das von anderen Fächern erwarten kann – wer eine Naturwissenschaft lernt, wird Ingenieur, das sieht so offensichtlich aus. Bei den künstlerischen Fächern ist es vielleicht weniger offensichtlich. Aber ich glaube, dass sie eine sehr gute Grundlage schaffen später kreativ zu arbeiten. Es ist immer eine große Gefahr, das Bildungssystem zu stark zu instrumentalisieren. Wir kennen die Arbeitswelt von heute, aber wir kennen die Arbeitswelt von morgen nicht. Die Fähigkeiten, die wir da brauchen, können ganz anders sein. Es muss uns immer darum gehen, Kinder für die Welt von morgen auszubilden.
Auch Entrepreneurship und Risikobereitschaft zählen Sie zu den Kompetenzen, die Schulen heute vermitteln sollen und die Sie bei der laufenden Pisa-Studie untersuchen. Sehen Sie denn Bildungssysteme, die das schon leisten?
In Flandern in Belgien und in den Niederlanden gibt es Beispiele. Ich habe Schulen besucht, in denen die Schüler Aktien tauschen und zwar zugunsten ihrer eigenen Kantine. Dort können Schüler aktiv das Wirtschaftsgeschehen gestalten. Dabei kann Schule viel leisten. Aber auch dieses Thema betrifft alle möglichen Schulfächer. Sie müssen Schülern mehr Verantwortung geben. Das Bildungssystem ist oft viel zu passiv und schafft viel zu wenig Raum für Aktivität.
Woher kam überhaupt das Bedürfnis, Kreativität in den Mittelpunkt der nächsten Untersuchung zu stellen?
Aus Deutschland jedenfalls kommen wenig neue Ideen. Die Leute hier wären zufrieden, wenn auch in 20 Jahren noch Mathematik, Naturwissenschaften, und Lesekompetenz testen würden. Den Verantwortlichen hierzulande wäre es auch am liebsten, wenn wir gar nichts am Test ändern würden, weil sie oft nur darauf schauen wollen, ob wir im Vergleich zur letzten Studie besser werden. Aber es gibt Länder, gerade im asiatischen Raum, für die Kreativität sehr wichtig ist. Dort wird sehr viel dran gearbeitet, vor allem in China, aber auch in Japan und Singapur. In Europa sind es Finnland und die Niederlande. Es gibt also eine Reihe von Ländern, die das vorangetrieben haben, aber Deutschland gehört nicht dazu. Die Frösche werden nie den Sumpf trockenlegen, das ist das Problem.
Wenn gerade die Chinesen so viel Wert darauf legen: Ist unsere Wahrnehmung des chinesischen Bildungssystems falsch, weil wir in diesem Zusammenhang oft nur von Drill und Druck hören?
Das ist so, ja. Zumindest hat sich dort in den letzten zehn Jahren sehr viel mehr getan, als in Europa. Kreativität spielt heute dort eine sehr große Rolle. Auch die digitalen Medien werden dort intensiv genutzt, um kreative Fertigkeiten zu fördern, um Schüler stärker individuell zu fördern. Die Chinesen machen das, weil ihnen sehr genau klar ist, welche Auswirkungen künstliche Intelligenz und Digitalisierung haben. Was man leicht unterrichten kann, das kann man auch leicht digitalisieren. Das ist das Dilemma. Aber in China ist ebendieses den Verantwortlichen eher bewusst.
Die Chance, dass Flüchtlingskinder hierzulande den Fachkräftemangel lindern, ist derzeit begrenzt, weil das Bildungssystem oft die Integration nicht schafft. Was muss sich ändern?
Natürlich ist es wichtig, soziale Mobilität zu stärken. Nur dann wird Migration und Zuwanderung wirklich zum Schlüssel zum Erfolg. Nur dann schaffen diese Entwicklungen neues Potenzial. Bei den Flüchtlingen kommt hinzu, dass viele schon außerhalb des Schulalters sind, das heißt unser Bildungssystem muss viel besser darin werden, lebensbegleitendes Lernen zur Realität werden zu lassen. Wenn wir nicht wissen, was ein syrischer Elektriker kann, wenn uns dafür die Instrumente fehlen, überhaupt festzustellen, was ein Abschluss dort wert ist, dann haben diese Menschen in unserer Gesellschaft nie gute Karten. Es kommt darauf an, Menschen dort abzuholen, wo sie sind, anstatt ihnen zu sagen, dass sie in unser System passen müssen. Und dann müssen wir uns darum kümmern, darauf aufzubauen und weitere Bildungsmöglichkeiten zu schaffen. Dass man das gut machen kann, zeigen uns traditionelle Einwandererländer, etwa die USA, Kanada und Australien.
Was machen die besser?
Sie fangen früher an, und sie haben Instrumente, erst einmal die Vielfalt der Menschen zu erkennen. Wenn Sie in eine Schule in Ontario gehen, die haben 40 Prozent der Schüler mit Migrationshintergrund. Die Lehrerschaft spiegelt also die Schülerschaft wieder.
Deutschland hat sich hingegen bei der Integration in das Bildungssystem eher schwergetan.
Wir haben die Kinder der Gastarbeiter der ersten Generation immer auf die Schulformen geschickt, auf denen sie nie eine Chance hatten. Die sind auf der Hauptschule gelandet, wo die Anforderungen für begabte Kinder relativ gering sind. Das Problem haben wir selbst geschaffen. Aber ich denke, da ist man heute schlauer. In Sachen Förderung von Schülern mit Migrationshintergrund hat sich in Deutschland auch viel getan. Da steht Deutschland heute viel besser da, als noch vor zehn oder zwanzig Jahren.
Das heißt bei der Integration in den Arbeitsmarkt sind Sie durchaus hoffnungsvoll?
Ja. Bei den Kindern, die heute geboren werden, sind wir auf einem guten Weg. Die große Herausforderung liegt in der weiteren Fortbildung. Gerade weil wir in Deutschland sehr an Abschlüsse glauben. In den USA kommen Sie als Migrant schnell in die Wirtschaft, weil die Leute schnell darauf schauen: Was können Sie eigentlich. Die formalen Credentials sind nicht so entscheidend. In Deutschland ist es anders, da schaut jeder: was haben Sie für ein Zertifikat. Deswegen ist es wichtig, besser zu erkennen, was Menschen aus unterschiedlichen Kontexten können.
Capital spricht immer zum Wochenende mit Vordenkern unserer Zeit – zu den großen Themen, die unsere Wirtschaft und Gesellschaft umwälzen. Bisherige Folgen: Dan Ariely, Wolfgang Reinhard, Frederik Pferdt, Brian Robertson, Lord Martin Rees, Martin Ford, Tyler Cowen, Barry Eichengreen, Sir Nigel Shadbolt, Peter Wippermann, Julian Nida-Rümelin, Björn Bloching, Raphael Gielgen und Ansgar Oberholz.