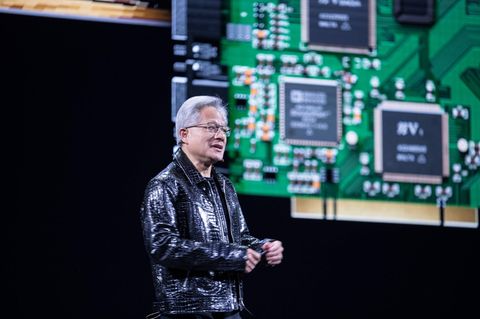Capital: Sie vergleichen in Ihrem jüngsten Buch die aktuelle Ära des Internets mit dem Wilden Westen. Können Sie das genauer erläutern?
TIM COLE: Damals wie heute sind die Menschen aufgebrochen, eine unbekannte und für sie fremdartige Welt zu erobern – eine Welt ohne Gesetz und Ordnung, in der nur die Macht zählte. Die Menschen haben damals dieses Land ganz langsam und mühevoll besiedelt, kultiviert und in einen blühenden Garten verwandelt. Im World Wide Web steht uns das erst noch bevor. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir es ebenso schaffen werden wie meine amerikanischen Vorfahren, die – wir sagen – den „Westen gewonnen haben.“
Wer sind denn dabei die Cowboys und wer die Indianer?
Man könnte sicher eine Analoge konstruieren zwischen den Web-Usern und den Hackern, aber darum geht es mir gar nicht. Viel wichtiger ist das, was gegen Ende des Wilden Westen geschah, als nämlich die großen Monopole entstanden, die die Menschen ausbeuteten und ihre Macht hemmungslos missbraucht haben – so wie es heute die großen Internetkonzerne tun: GAFA – Google, Amazon, Facebook und Apple. Ich zitiere in dem Buch das Beispiel der „Räuberbarone“ wie John D. Rockefeller, der Standard Oil mit ruchlosen Methoden zum wertvollsten Unternehmen seiner Zeit machte. Er schenkte beispielsweise den Chinesen Lampen und machte sie damit von seinem Öl abhängig. Genauso ruchlos war Steve Jobs, der Apple zum wertvollsten Unternehmen unserer Zeit gemacht hat; nicht etwa, indem er so viele iPhones verkauft hat, sondern indem er uns süchtig gemacht hat nach seinen Apps und seiner iTunes-Musik, ohne die viele von uns heute gar nicht mehr leben wollen. Die GAFA-Unternehmen haben es verstanden, sich in unser Leben einzuklinken und sich an dem Strom von Daten zu bedienen, die wir ihnen frei Haus liefern – ohne dass wir ein Mitsprachrecht hätten, wie diese Daten verwendet werden, und ohne dass man wenigstens unsere Daten ausreichend vor Diebstahl und Missbrauch schützen würde.
Welche Rolle spielt Deutschland in diesem digitalen Wilden Westen?
Deutschland ist ein Teil Europas, und Europa spielt gerade eine führende Rolle bei der Schaffung von Recht und Ordnung in Internet. Denken Sie nur an die zu Unrecht verspottete DSGVO. Andere Länder – allen voran Amerika – beneiden uns heute um dieses Gesetz, das ein erster Schritt gewesen ist, um unser gemeinsames Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung auch wirklich umzusetzen. Ja, das Gesetz ist leider etwas amateurhaft, aber man kann es ja nachbessern. Aber in Kalifornien beispielsweise denkt man gerade darüber nach, wie sie ein Gesetz nach dem Vorbild der DSGVO bei sich einführen könnten.
Und welche Rolle spielt China? Das Land hat im technologischen Bereich ja eine rasante Entwicklung gezeigt …
Bislang fand in China alles hinter der großen Firewall statt, also haben wir davon nicht so viel mitbekommen. Das ändert sich gerade, denn die großen Internetkonzerne im Reich der Mitte – die Baidus, Tencents, Alibabas und Xiaomis – wollen expandieren. Das Problem ist, dass China ein autokratisch regiertes Land ist, und da sind ethische Konflikte vorprogrammiert. Nicht, dass ich als Amerikaner besonders stolz auf das bin, was sich gerade in Amerika abspielt. Aber wenn wir gedacht haben, GAFA seien prinzipienlose Gierkapitalisten, dann warten Sie erst einmal ab, bis die Chinesen kommen!
Wie groß ist der Schaden aus dieser unregulierten Landschaft für die Gesellschaft?
Immens. Die GAFA-Unternehmen halten sich an keine Spielregeln, sie zahlen, wenn überhaupt nur höchst widerwillig Steuern, und sie kümmern sich nicht um fairen Wettbewerb. Nicht umsonst verhängt die EU in letzter Zeit Rekordstrafen gegen die großen Internetkonzerne. Im Juli waren es 4,34 Mrd. Euro gegen Google wegen Missbrauchs der Marktmacht. Facebook droht eine Strafe von 1,4 Mrd. Euro wegen ihrem laxen Umgang mit Kundendaten. Apple musste neulich Steuern in Höhe von 13 Mrd. Euro nachzahlen. Okay, das leisten die sich alle aus der Portokasse – noch. Aber irgendwann wird es auch ihnen weh tun.
Wie stark hängt denn Ihrer Meinung nach der Aufstieg des Populismus mit all dem zusammen?
Die Tech-Konzerne verstärken bei den Menschen das Gefühl, machtlos und fremdbestimmt zu sein. Stimmt ja auch! Dabei haben wir kleinen Leute ja ein ungeheures Machtmittel, vor dem sich selbst GAFA fürchten muss: das Internet! Als Verbraucher entscheiden wir darüber, welches Unternehmen am Ende die Nase vorne hat. Und wenn uns etwas nicht passt, haben wir einen Kommunikationskanal, über den wir uns austauschen und mit anderen zusammenschließen können. Schauen Sie sich nur die Entwicklung der Nutzerzahlen bei Facebook an: Denen laufen vor allem die jungen User scharenweise davon! Deshalb wird heute ganz offen darüber diskutiert, wer wohl der Nachfolger von Facebook im Social Web sein wird. Und Jeff Bezos hat neulich in einer Betriebsversammlung seine Leute gewarnt, dass auch Amazon eines Tages scheitern könnte – so wie Sears Roebuck, das noch in den Zeiten des Wilden Westens gegründet wurde, zum größten Handelsunternehmen seiner Zeit aufstieg und vor ein paar Monaten in die Pleite abrutschte.
Wie kann eine neue Ethik im Umgang mit Daten aussehen?
Eine Gesellschaft funktioniert nicht ohne Spielregeln. Nichts anderes sind Ethik und Moral. Das Problem ist nur, dass viele unserer ethischen Leitlinien nicht mehr zeitgemäß sind oder zu kurz greifen. Wenn ein selbstfahrendes Auto eine Entscheidung über Leben und Tod von Menschen fällen muss, was unweigerlich kommen wird, dann sollten wir doch uns vorher darüber einig werden, nach welchen Regeln es diese Entscheidung trifft – denn schließlich könnte es ja uns treffen. Ich denke, wir brauchen eine breite Diskussion darüber, was im Digitalzeitalter ethisch ist und was nicht. Wir brauchen auch Ethikunterricht in den Schulen, den Unis und den Ausbildungsstätten. Und ich gehe noch einen Schritt weiter: Ich fordere einen Ethikbeauftragten in jedem größeren Unternehmen – so wie es heute selbstverständlich einen Datenschutzbeauftragten gibt. Seine Aufgabe wird es sein, die Firmenleitung, aber auch die Konstrukteure und Programmierer, in ethisch kniffeligen Situationen zu beraten und notfalls auch ein Veto einzulegen.
Das klingt eher nach einem weichen Mittel zur Bändigung. Reicht das wirklich aus?
Selbstverständlich nicht. Wir brauchen Regulation, beispielsweise ein neues Wettbewerbsrecht, das auf das Digitalzeitalter anwendbar ist, und dass Dinge wie Brain Trusts und Datenmonopole genauso verhindern kann wie verbotene Preisabsprachen oder Anbieterkartelle. Noch wichtiger aber wird Selbstregulierung sein: Die großen Internetkonzerne sollen sich selbst zu ethisch sauberem Wettbewerb verpflichten. Interessant, dass es gerade die Mitarbeiter der GAFA-Unternehmen sind, die ganz aktuell ihren Chefs Kontra geben und sich weigern, an Produkten und Dienste mitzuwirken, die sie für unethisch halten, so wie Googles Vorhaben, eine zensiertes Suchmaschine für den chinesischen Markt zu entwickeln oder Microsofts Geschäfte mit dem US-Verteidigungsministerium in Sachen Cloud Computing.
Was kann, was muss der Staat tun? Kann er in einer digitalisierten und globalisierten Welt überhaupt etwas tun?
Wir brauchen so viel Regulierung des World Wide Web wie nötig – und so wenig wie möglich. Ich verspreche mir, ehrlich gesagt, von der heutigen Politikergeneration nicht viel, denn die sind nicht in der digitalen Welt zuhause. Aber es wird ja irgendwann eine Wachablösung geben, und die jungen Politiker werden es hoffentlich besser machen. Das wird dauern – aber der Wilde Westen ist auch nicht über Nacht gezähmt worden.
Was glauben Sie, wie lange wird es noch dauern, bis sich die Wildheit gelegt hat und eine „Zivilisierung des Internets“, wie Sie es nennen, einkehrt?
Das wird ein Marathon und kein Sprint. Aber die gute Nachricht ist: Wir stehen in der Entwicklung des World Wide Web und der Digitalen Gesellschaft ja noch ganz am Anfang. Was sind 25 Jahre, historisch gesehen? Bis der Sherman Act von 1890, der die Macht der Räuberbarone und der Monopolisten des Wilden Westens an den Zügel nahm, tatsächlich gegen Standard Oil erfolgreich angewandt wurde, dauerte es bis 1911, also auch mehr als 20 Jahre. Wir müssen Geduld haben – aber wir dürfen nicht nachlassen. Immerhin geht es um unser aller digitaler Zukunft.