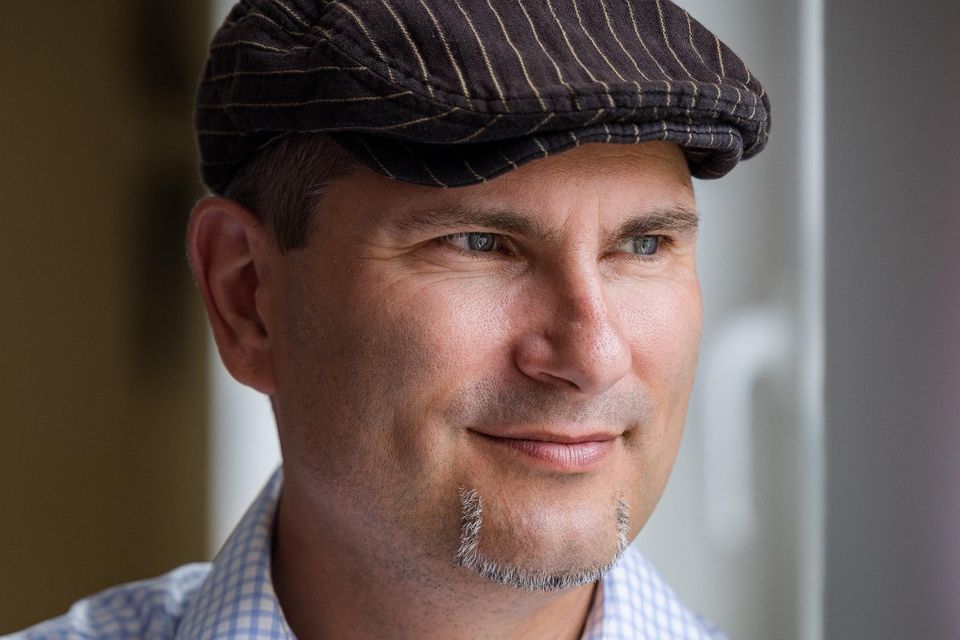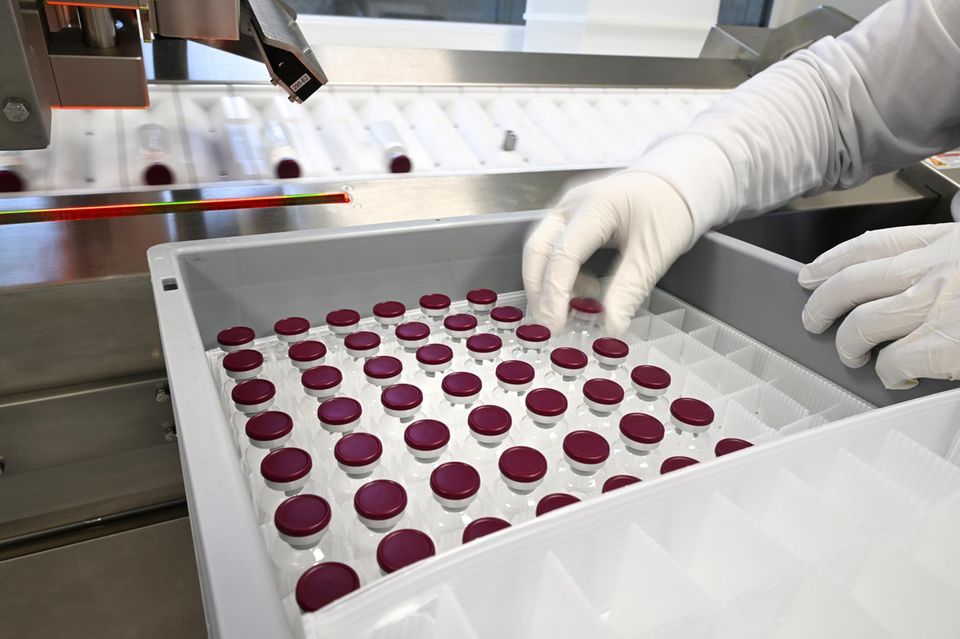Was für ein Abend: Letzten Sonntag ging es hoch her um mich herum im „Golfo de Biscaia“. Diese urige Pinxo-Bar mitten in der Altstadt von Barcelona ist kulinarisch nichts Besonderes, doch die Stimmung in dem Laden ist während der Sportübertragungen einfach fantastisch. Und dann gewinnt – nach dem Wimbledon-Sieg des Spaniers Carlos Alcaraz am Nachmittag – Spanien auch noch das EM-Finale!
Es gab kein Halten mehr.
Una cultura fantástica
Entgegen allen Gepflogenheiten formierten sich Autokorsos, die ganze Stadt war auf den Beinen. Die Fans lagen sich in den Armen, die Kommentatoren überschlugen sich vor Begeisterung und alle waren sich einig: Dieser Erfolg sei Folge des großartigen Teamspirits. Der Trainer habe eine fantastische Kultur hergestellt, nur so habe er das begeisternde Fußballspiel Spaniens weiterentwickeln können.
Über diese Aussagen sinnierte ich, während ich – einerseits etwas traurig über das vorzeitige Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft, andererseits genussvoll ob der kollektiven Freude um mich herum – durch die feiernde Menge nach Hause schlenderte.
Die mantraartig wiederholten Überzeugungen zu Spirit und Kultur: Sie sind zwar wunderbar eingängig, aber leider Quatsch.
Morgendliches Kulturtraining
Lassen Sie mich bei der Aussage anfangen, dass Luis de la Fuente die Kultur in der Mannschaft aktiv entwickelt hätte. Das klingt, als habe der Trainerstab jeden Morgen gleich nach dem Warmmachen eine Einheit Kulturtraining angesetzt, um auch auf diesen Gebiet eine bessere Technik einzuüben.
Doch Kultur ist keine Technik und Kultur ist kein Spirit.
Hier bei uns
Kultur umschreibt die eingerasteten Kommunikationsmuster eines Kollektivs. Kultur ist Ausdruck eines „so läuft das hier bei uns“. Im Unterschied zur Technik entstehen diese Muster stets von selbst, sie müssen nicht entwickelt werden.
Sie KÖNNEN nicht einmal entwickelt werden, denn Kultur bildet sich – wie der Systemtheoretiker Luhmann es so schön ausdrückte – hinter dem Rücken der Akteure. Daher entwickelt sich Kultur auch nie in der Art, wie die Akteure es gerne hätten – weder in Fußballteams noch in Unternehmen. Die Erfahrung aus vielen gescheiterten Changekultur-Projekten spricht Bände.
Interessant ist, dass sich dennoch das Managementziel „Unternehmenskultur verbessern“ größter Beliebtheit erfreut.
Ein bewährtes Rezept
Den dringenden Wunsch danach kann ich gut nachvollziehen: Schließlich führt eine individuell als schlecht empfundene Unternehmenskultur nachweislich zu mehr Fluktuation und weniger gute Bewerber.
Und das Vorgehen entspricht darüber hinaus dem bewährten Managementrezept „Setze den Hebel an dem Punkt an, an dem es hakt“: Stimmt etwas mit der Qualität nicht, so arbeite an der Qualität. Stimmt etwas mit den Kosten nicht, so arbeite an den Kosten. Und stimmt etwas an der Unternehmenskultur nicht, so arbeite an der Unternehmenskultur.
In diesem Fall hat die Anwendung jedoch gleich zwei Haken. Erstens ist Kultur nie kaputt und muss demnach auch nicht repariert werden. Zweitens hat Kultur keinen Hebel. Sie ist eben etwas anderes als Qualität und Kosten. Sie lässt sich nicht zielgerichtet steuern.
Was nicht heißt, dass Sie Kultur nicht beeinflussen können – und damit komme ich zu der zweiten Aussage der spanischen Kommentatoren: Dass Erfolg eine Folge der richtigen Kultur ist. Es ist genau umgekehrt.
Kultur und Erfolg
Wenn es eines gibt, das die Stimmung als Ausdruck von Kultur befeuert, ist es Erfolg. Das können Sie an jeder Fußballmannschaft beobachten: Ist das erste Tor gefallen und haben die Spieler das Gefühl, dass es läuft, kann die gewagteste Flanke ankommen. Wechselt der Trainer den berühmt-berüchtigten Joker ein, kann ein Ruck durch die Mannschaft gehen, alle geben noch einmal Gas und besiegeln den Triumph.
Das gleiche gilt für Ihr Unternehmen: Spürbare Erfolge sind auch dort ein entscheidender Faktor dafür, wie sich die Kultur entwickelt. Und wann stellen sich Erfolge ein? Wenn die Wertschöpfung funktioniert, zu Markt sowie Kunden passt und besser als die der Wettbewerber ist.
Kultur und Wertschöpfung
Wir nennen das in unserem Unternehmen die „wertschöpfungsorientierte Unternehmenskulturentwicklung“: Sie fahnden nach den Schwachstellen in Ihrer Wertschöpfungskette und beheben sie. Damit entwickeln Sie zwar Ihre Unternehmenskultur nicht direkt – was ja auch, wie gesagt, nicht geht. Sie schaffen jedoch die besten Voraussetzungen dafür, dass die Kultur sich selbst verbessert.
Aus meiner Sicht lässt sich zum Beispiel das im Vergleich zu den letzten Turnieren gute Abschneiden der Deutschen Mannschaft so erklären: Bundestrainer Julian Nagelsmann ist es gelungen, sich auf seine Wertschöpfung zu konzentrieren, also das Fußballspiel seines Teams zu verbessern. Und das führte dazu, dass er die Kultur am Ende – mit Tränen in den Augen – feiern durfte.
Jetzt könnten Sie meine Ausführungen missverstehen, dass Sie Ihre Unternehmenskultur einfach ignorieren dürfen – wenn Sie sie eh nicht steuern können. Ganz so ist es nicht. Im Gegenteil. Die Unternehmenskultur ist ein extrem wertvoller Indikator.
Kultur als Seismograph
Geht es mit Ihrer Unternehmenskultur bergab, ist das ein untrügliches Zeichen, dass mit der Wertschöpfung etwas nicht (mehr) stimmt. Wie ein Seismograph schlägt die Unternehmenskultur sehr fein auf solche Störungen an: Vielleicht sind die Kunden nicht mehr zufrieden, vielleicht hapert es an der Flexibilität oder der Geschwindigkeit, vielleicht hat der Wettbewerber bessere Ideen.
All das wirkt sich nicht nur auf ihre Geschäftszahlen, sondern auch auf die Stimmung aus, der Ton wird rauer, die „save your ass“-Taktik opportuner. Solche Ausschläge sollten Sie hellhörig machen: Wo könnten die ihren Ursprung haben? Die Spur ist oft nicht so leicht zu finden. Vor allem, weil sie oft von der schlimmsten aller Managerkrankheiten verdeckt wird: der Personifizierung von Problemen.
Die schlimmste Managerkrankheit
Meiner Erfahrung nach kommen Sie mit der Suche nach Schuldigen nie weit. Personifizieren Sie ein Problem, bleibt die wahre Problemursache meist verborgen. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass das Problem immer wieder auftaucht, auch wenn die beschuldigten Personen schon längst anderen gewichen sind.
Die Alternative ist, die Ursache für Missstände im institutionellen Rahmen zu suchen: Welches Umfeld veranlasst Mitarbeiter und Führungskräfte so zu handeln, wie sie handeln?
Der Sinn im Unsinn
Ein Beispiel: Statt den Teamleiter Müller auf eine andere Stelle „wegzuloben“, weil er angeblich nicht in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen, hilft folgende Frage: Wieso ist es „sinnvoll“, dass die Mitarbeiter keine Verantwortung übernehmen? Welches Problem lösen sie damit?
Die – zugegeben arg verkürzte – Begründung könnte vielleicht lauten: Unsere Mitarbeiter übernehmen keine Verantwortung, weil wir sie in unserer Matrixstruktur mit so vielen Projekten höchster Priorität bombardieren, dass es für sie „sicherer“ ist, auf Grundsatzentscheidungen von ganz oben zu warten: Sie müssten sonst befürchten, dass sie einem der Projektleiter oder Vorgesetzten auf die Füße treten.
Das nächste Finale
Nutzen Sie daher die Unternehmenskultur als Messinstrument. Beobachten Sie sie regelmäßig und arbeiten Sie an Ihrer Wertschöpfung. Dann können Sie wie Julian Nagelsmann nach dem Ausscheiden seiner Nationalmannschaft halb selbstbewusst, halb augenzwinkernd verkünden: „Dass man zwei Jahre warten muss, dass man Weltmeister wird, tut weh.“
Wenn er statt an der Kultur weiterhin am Spiel der deutschen Nationalmannschaft arbeitet – wer weiß. Ich hätte nichts dagegen, in zwei Jahren im „Golfo de Biscaia“ ein Finale Spanien gegen Deutschland zu verfolgen. Und Sie?