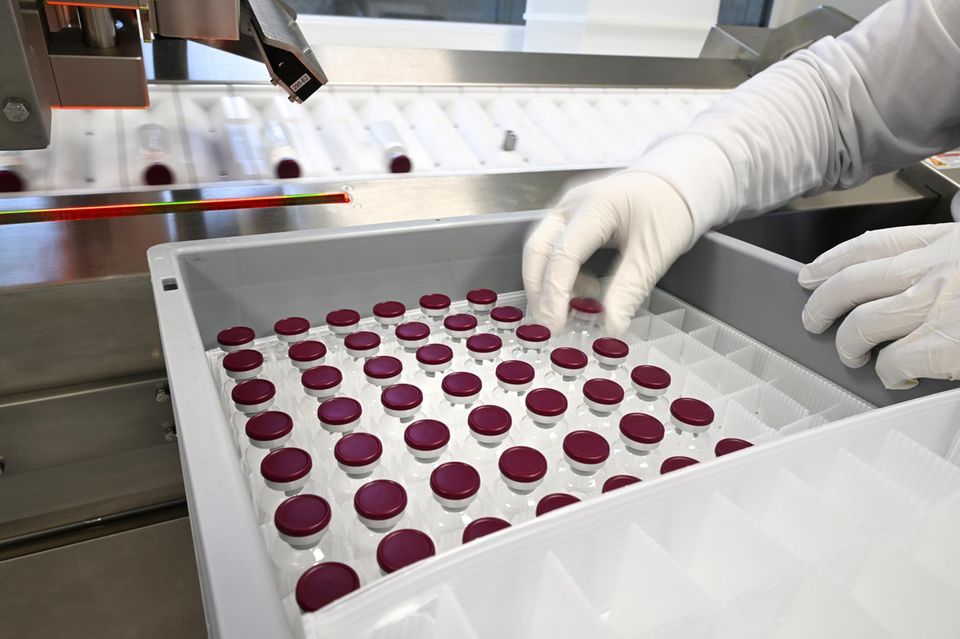Herr General, es wird über eine Wiedereinführung der Bundeswehr debattiert. Was können junge Menschen in der Truppe über Führung lernen?
MICHAEL MATZ: Sie lernen das System zunächst einmal von innen kennen. Am Ende aber haben sie die Möglichkeit – und das war immer die große Stärke der Wehrpflicht – sich weiterzuverpflichten und sich zum militärischen Vorgesetzten ausbilden zu lassen. Ziel ist es deshalb natürlich, dass die jungen Menschen in der Ausbildung einen Vorgesetzten erleben, der Vorbild sein könnte.
In der Bundeswehr gilt das Prinzip „Befehl und Gehorsam“. Trotzdem sagen Sie: Kreativität ist gefragt. Wie geht das zusammen?
Wir führen „mit Auftrag“. Das heißt: Der militärische Vorgesetzte erklärt, wie er eine Problemstellung lösen möchte. Den Nachgeordneten bekommen Aufträge, die sie aber nicht in ein stures Schema pressen und von A bis Z festlegen, wie was wo zu tun ist. Der Anführer setzt stattdessen auf den Intellekt, die Leistungsfähigkeit und Erfahrung seiner Untergebenen. Die wissen im Umkehrschluss genau, was der Vorgesetzte erwartet und überlegen eigenständig, wie sie das umsetzen – in gewissen Schranken, natürlich.
Das klingt überraschend stark nach agiler Führung. Wird so auch die Bundeswehr resilient?
Ja, denn reißt die Verbindung zwischen der Führung und dem Team ab – zum Beispiel, weil die Funkgeräte nicht funktionieren – kann man trotzdem weiterarbeiten. Ich habe vor meinem Büro ein Schild stehen. Auf dem sind Konjunktive wie „Könnte“ oder „Hätte“ durchgestrichen. Stattdessen steht da „Machen“. Der Führungsnachwuchs soll Verantwortung übernehmen. Das setzt bei Vorgesetzten aber eine Fehlerkultur voraus.
Wie sieht die aus?
Wenn jemand einen Fehler macht, wird er nicht gleich bestraft. Sondern es wird klargestellt, was stattdessen gefordert war. Ich habe in 45 Jahren bei der Bundeswehr Zehntausende von Menschen geführt und keinen einzigen abgelöst, also von seinem Dienstposten entfernt. Den einen oder anderen musste ich allerdings wegen Dienstvergehen bestrafen.
Wie bauen Vorgesetzte Vertrauen auf?
Viele Grundsätze guter Führung kann man lernen. Aber wer empathielos durch die Welt geht, hat es schwieriger. Ich sage: Wer Menschen führt, muss Menschen mögen. Und dafür ist es ganz wichtig, dass man seine Untergebenen, die einem anvertraut wurden, kennt.
„Ich bin sehr für das berühmte Pausengespräch“
Was heißt „kennen“ in diesem Zusammenhang?
Dass ich nicht nur den Namen und Dienstgrad kenne. Ich muss schon wissen: Was hat er oder sie vor der Bundeswehr getan, wie sieht das persönliche Umfeld aus, welche Stärken und Schwächen gibt es? Mit diesem Wissen können Sie Aufträge ganz anders an den Mann oder die Frau bringen.
Wie lernen Sie Ihre Untergebenen besser kennen?
Man muss sich Zeit nehmen. Ich bin sehr für das berühmte Pausengespräch, früher gern in der Raucherecke. Ich bin auch mal bereit, abends ein Glas Bier oder Cola zu trinken und zwei Stunden lang Fragen zu beantworten.
Es gibt Vorgesetzte, die wollen diese persönliche Schiene nicht, sondern vor allem Resultate sehen.
Es kann Ihnen natürlich wurscht sein, ob eine Aufgabe von Kollege A oder B erledigt wird. Aber einer von beiden kann es vermutlich besser. Und das zu wissen, nützt am Ende auch dem Vorgesetzten.
Was sagen Sie zu dem Einwand, dass es ein solcher Führungsstil viel zu zeitaufwendig ist?
Der Mensch steht immer im Mittelpunkt unserer Betrachtung. Jungen Menschen muss man vorleben, was es bedeutet, eine militärische Führungskraft zu werden. Ich bin hoch präsent. Ich gehe nach unserem Gespräch zu einer Ausbildung, bei der ich den Ausbilder und alle Teilnehmer genau kenne. Ich muss dem Ausbilder nicht auf die Finger schauen, aber meine Präsenz ist ein Zeichen von Wertschätzung.
Und die benötigt Zeit?
Wer Laufbahn will, kommt vielleicht mit 40 Stunden pro Woche aus. Für eine Karriere reicht das nicht. Ich fülle meine zusätzlichen Stunden – rund 20 pro Woche – mit der Interaktion mit Menschen. So nah an meinen Männern und Frauen zu sein, hat sich gerade im Einsatz sehr bewährt.
„Empathie muss man mitbringen“
Sie waren 1998/1999 erstmals im Auslandseinsatz, in Bosnien. Hat das Ihre Sicht auf Führung verändert?
Der Schnitt kam später. Mit die schwierigste Zeit habe ich 2009/2010 als Kommandeur der schnellen Eingreiftruppe im Norden Afghanistans erlebt, wo wir gegen Aufständische gekämpft haben. Ich habe es geschafft, alle Männer und Frauen gut nach Deutschland zurückzubringen. Das lag nicht nur an guter Führung. Aber es hat das Vertrauen in die Führerausbildung bestärkt. Ist man auch mental gut vorbereitet, dann funktioniert man in Extremsituationen. Auf der anderen Seite wächst man weiter zusammen, wenn der Anführer auch in einer Extremsituation Teil der Truppe ist.
Muss man sich als guter Anführer zu 100 Prozent mit der Organisation identifizieren oder ist Skepsis durchaus von Vorteil?
Die Ja-Sager-Typen haben wir in unserem Land zu verschiedenen Epochen genug gehabt. Eine Lehre aus dieser Geschichte ist, dass ein Soldat einen Befehl nicht befolgen darf, wenn es sich um eine Straftat handelt. Ich habe noch nie einen Auftrag nicht erfüllt. Aber ich bin auch Staatsbürger mit meiner eigenen Meinung. Unser Auftraggeber ist der Deutsche Bundestag. Dem gegenüber bin ich loyal. Loyalität muss da sein, aber kein Kadavergehorsam, sondern gesundes Mitdenken.
Abschließend gefragt: Wen würden Sie eher befördern – den Kandidaten mit hervorragendem Fachwissen oder jemanden, der sehr gut mit Menschen umgehen kann?
Für mich ist derjenige mit guter Menschenführung der stärkere Kandidat. Fachwissen kann man lernen. Führung wird natürlich auch gelehrt, aber da geht es nur um Grundsätze. Die Empathie muss man mitbringen. Wir merken im Gespräch sofort, wenn jemand bereits Erfahrung im Führen von Menschen hat, weil er zum Beispiel in der Schule oder im Verein Verantwortung übernommen hat. So jemand bekommt immer dem Vorzug vor dem Technokraten.