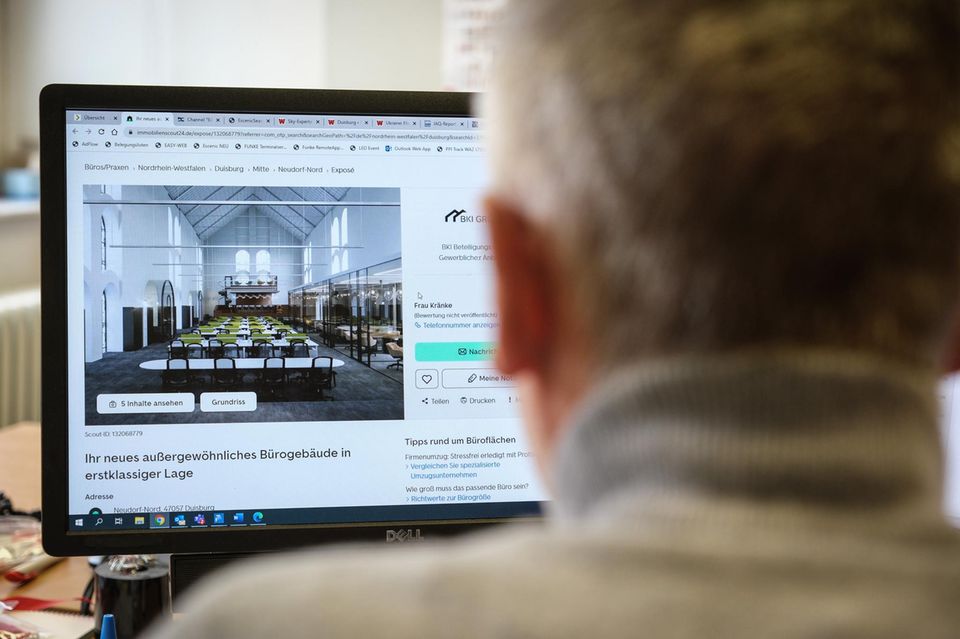Die wirtschaftliche Stagnation macht es überdeutlich: Für etliche Unternehmen in diesem Land steht ein größerer Wandel an. Und auch wenn sich die meisten Firmen richtig ins Zeug legen: Eine Aufbruchstimmung, die ihren Namen verdient, kommt nicht auf. Die wäre aber dringend erforderlich, um dem Wandel Schwung zu verleihen. Woran hakt es?
Die häufigste Aussage, die ich in den Führungsetagen hinter mehr oder weniger vorgehaltener Hand dazu zu hören bekomme, ist: „Wir haben alles versucht, aber unsere Belegschaft wehrt sich gegen jede Veränderung.“
Ich würde Ihnen in diesem Punkt gerne einen Perspektivwechsel anbieten.
Der individuelle Widerstand
In dieser Aussage steckt der Vorwurf, dass die Mitarbeiter sich individuell und grundsätzlich, also qua Persönlichkeit, jedem Wandel verweigern.
Das mag auf Einzelne auch zutreffen, die vielleicht gerade große familiäre Probleme und deshalb keinen Kopf für Veränderungen haben. Der eine oder andere leistet möglicherweise auch taktischen Widerstand, weil es ihm persönlich oder karrieretechnisch zupass käme, wenn irgendein Change-Projekt krepiert oder zumindest versickert. Die Zahl ist aber insgesamt gering.
Die deutlich größere Zahl an Mitarbeitern ist durchaus bereit für Wandel, sie sehnen ihn sich regelrecht herbei. Diese Mitarbeiter sind es höchstens inzwischen leid, ständig unterstellt zu bekommen, sie seien die Blockierer. Und manch einer findet Wandel prinzipiell prima, nur die vorgeschlagene Maßnahme unsinnig.
Diese beiden Formen sind aber nicht unter „individueller Widerstand“ einzuordnen. Sie gehören vielmehr in die Kategorie „organisationaler Widerstand“.
Abwehrreaktion
Lassen Sie mich diesen organisationalen Widerstand anhand einer Analogie beschreiben. In gewisser Weise ähnelt ein Unternehmen nämlich dem menschlichen Körper: So wie dieser über ein Immunsystem zur Abwehr von Störfaktoren verfügt, ist auch jeder Organisation ein Abwehrmechanismus immanent.
Dringen Krankheitserreger oder Gifte in den Körper, wird das Abwehrsystem aktiviert. Das reagiert übrigens auch auf Medikamente, weshalb diese oft mit Mechanismen ausgestattet werden müssen, um diese Abwehr zu überlisten. Das biologische System an sich unterscheidet nicht zwischen gut und böse.
So ähnlich ist das auch bei Organisationen: Ob eine Veränderung in guter oder böser Absicht angestoßen wird, macht zunächst keinen Unterschied. Es reagiert so oder so. Das ist auch sehr hilfreich, denn sonst könnte jeder x-beliebige Fatzke von außen in die Büroräume marschiert kommen und erfolgreich brüllen, alle müssten jetzt dies oder jenes tun. Der Immunapparat hält also in allererster Linie gesund. Und das ist nicht die einzige Ähnlichkeit.
Management: Change-Prozesse funktionieren oft nicht
Bei jedem Menschen zeigt sich die Abwehrreaktion des Körpers ein bisschen anders und nicht selten fernab von der Ursache: Die einen bekommen im Zuge einer Viruserkrankung unglaubliche Kopfschmerzen, die anderen Verdauungsprobleme und die nächsten klagen über Rücken.
Genauso kann sich die organisationale Abwehr in ganz unterschiedlichen Reaktionen und in teils abwegigen Situationen zeigen: Da wird plötzlich die Verwendung englischer Methodenbegriffe bei der Umsetzung auf agiles Projektmanagement kritisiert. Oder das vermeintlich geringe Weiterbildungsbudget als Gegenargument für eine Reorganisation des Vertriebs herangezogen.
Und genau wie die Magentablette die Virusinfektion nicht kuriert, so entfachen Sie keine Aufbruchstimmung, indem Sie die agilen Fachbegriffe eindeutschen oder in Budgetverhandlungen einsteigen, um den Widerstand aufzulösen und die Stimmung zu verbessern. Wohl deshalb habe ich noch fast nie erlebt, dass die üblichen Change-Ansätze funktionieren.
Billige Floskeln
Diese Ansätze gehen nämlich von der Idee aus, dass die Mitarbeiter sich persönlich als Opfer sehen und vom Gegenteil überzeugt werden müssen – „Betroffene zu Beteiligten machen“, „Alle ins Boot holen“ und so weiter. Sie kennen das sicher. Aber das ist in den meisten Fällen Quatsch. Die sitzen doch schon im Boot. Und die wollen auch alle mitfahren. Sonst hätten sie schon längst gekündigt.
„Die“ müssen nur das Gefühl haben, dass das mit dem Wandel ernst gemeint ist und sich nicht schon wieder in billigen Floskeln und Belanglosigkeit verliert. Denn diese Erfahrung haben die meisten schon zur Genüge gemacht.
Echte Probleme thematisieren
Ein gut erprobtes Mittel, die organisationale Abwehr zu überwinden und endlich Aufbruchstimmung zu erzeugen, ist – salopp ausgedrückt – den Elefanten im Raum zu finden und zu benennen. Was steht uns eigentlich wirklich im Wege, um die Lieferzeit zu halbieren, die nächste Messe mit besseren Produkten zu fluten oder die Qualität endlich in den Griff zu bekommen?
Dieser Elefant ist fast immer mit einem Tabu belegt. Das heißt, viele oder vielleicht sogar alle wissen, dass er da ist, aber keiner redet darüber. Das kann das kooperationsverhindernde Vergütungssystem sein oder das Ampelreporting, das ständig Business-Theater provoziert, oder das Fehlen einer wirklich handlungsleitenden Strategie. Diese Themen sind in Meetings nicht besprechbar. Stattdessen werden Nebenkriegsschauplätze zur Besprechung vorgeschoben. Und jeder stöhnt innerlich, weil er weiß, dass nur das nächste Pseudoproblem diskutiert wird.
Dann werden wieder Plakate gemalt, auf Haltungen gepocht, Führungsleitlinien erstellt, und alle müssen auf Workshops gehen, um sich „abholen“ zu lassen. Der Knackpunkt ist deshalb, sich auf die Suche nach den Elefanten zu machen und diese dann öffentlich anzusprechen.
Substanz statt Eiertanz
Mit öffentlich meine ich natürlich nicht vor dem großen Publikum da draußen, sondern firmenintern – aber eben bitte nicht nur vor Einzelnen oder im kleinen Managementkreis. Viele im Unternehmen müssen das hören können, damit jeder daran gefahrlos im Meeting erinnern kann. Ist das Tabu erst einmal gebrochen, kann über echte Probleme und echte Lösungsansätze gesprochen werden.
Sie können sicher sein, dass sich diese Neuigkeit wie ein Lauffeuer im Unternehmen verbreitet. Endlich geht es an die Substanz und nicht mehr nur um Eiertanz. So entsteht echte Aufbruchstimmung.
Jetzt wäre es ein Leichtes, den Bogen zu der gesellschaftlichen Perspektive zu schlagen. Schließlich steht das ganze Land vor einem größeren Wandel, während es gleichzeitig an der positiven Stimmung hapert. Doch das politische Spiel ist ein anderes. Da gehört zum Beispiel taktischer Widerstand zum Geschäft, weil man ja wiedergewählt werden will.
Deshalb verspreche ich mir stimmungstechnisch erst einmal wenig von der Politik. Umso mehr würde ich mir wünschen, dass wir wirtschaftlichen Entscheider hierzulande in unseren Unternehmen den Beweis antreten, dass der Wandel nicht am individuellen Widerstand der Mitarbeiter und Bürger scheitert. Vielleicht traut sich dann auch die Politik, die Elefanten im Raum mutig zu benennen, statt sich in Belanglosigkeiten zu verlieren. Das wäre ein echter Beitrag zur Aufbruchstimmung in diesem Land.