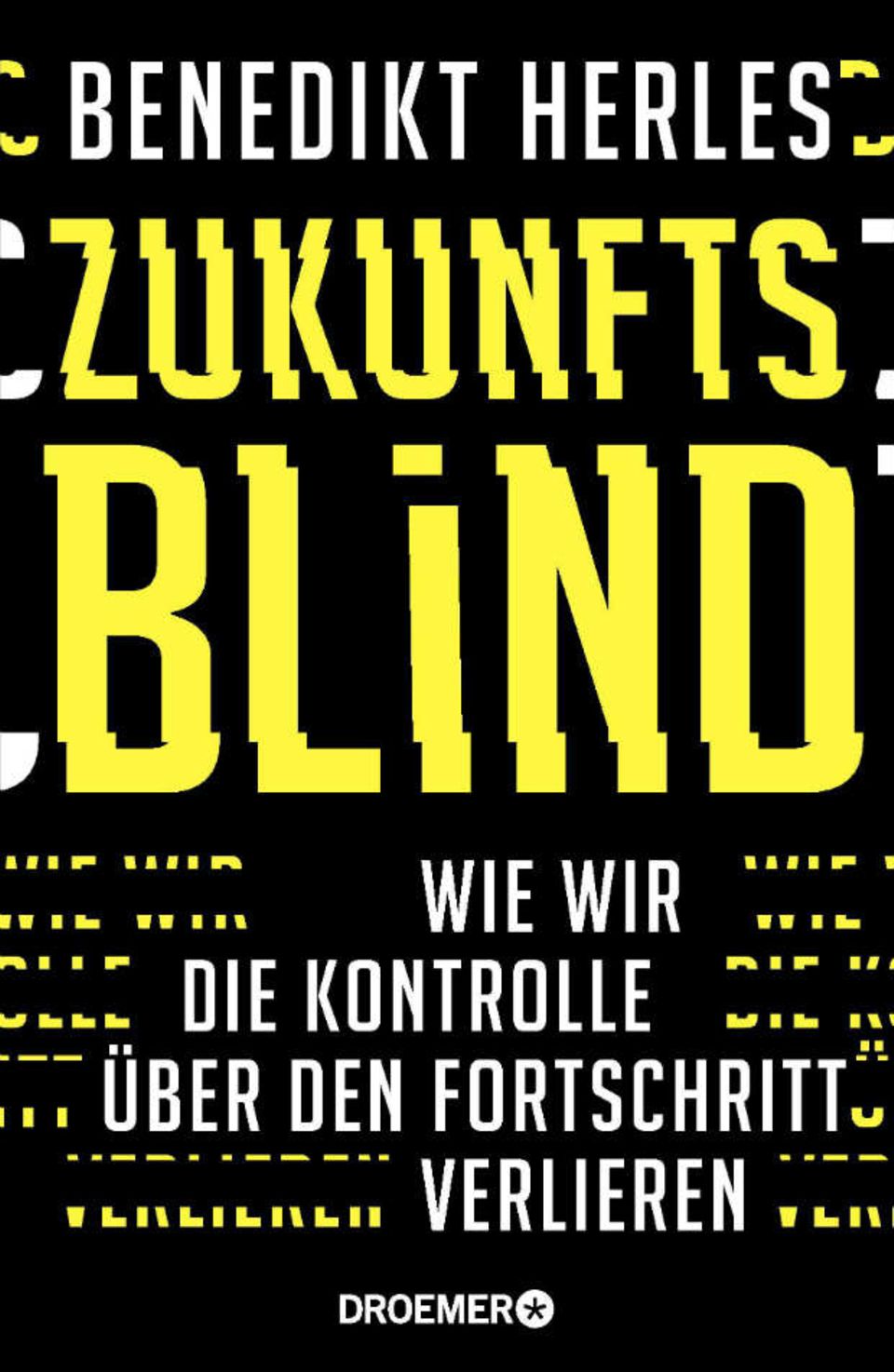Man könnte sagen, das Start-up mit dem schönen Namen Ginko Bioworks ist komfortabel finanziert. Seit seiner Gründung im Jahr 2009 konnte das in Boston beheimatete Unternehmen rund 430 Mio. Dollar Risikokapital einsammeln, unter anderem von Bill Gates höchstpersönlich. Die Investoren-Fantasie ist nachvollziehbar. Ginko arbeitet an genetisch optimierten Mikroorganismen für den Einsatz in Industrie, Landwirtschaft und Pharmazie. „Biology by design“ ist auf der Firmenwebsite zu lesen. Das Start-up sieht sich als transdisziplinäres Technologie-Unternehmen. Für die Züchtung der manipulierten Lebewesen verwendet es Labore voll smarter Software und Robotik. Aus Biologen werden dort Designer. Am Computer („in silicio“) schaffen sie organische Innovationen. Möglich ist fast alles – vom Hochleistungs-Hefepilz bis zum Power-Enzym.
Ginko Bioworks ist in einem völlig neuen Forschungsfeld unterwegs: Der sogenannten synthetischen Biologie, beheimatet an der Schnittstelle von Molekularbiologie, organischer Chemie, Nanotechnologie und Informatik. Die synthetische Biologie steckt noch in den Kinderschuhen, aber ihre Ambitionen sind gewaltig. Deren Vertreter machen sich mit Hochdruck daran, den genetischen Plan des Lebens kommerziell nutzbar zu machen. Aus ihrer Sicht ist die Mikrobiologie nichts anderes als natürliche Nanotechnologie. Und diese lässt sich zunehmend flexibel einsetzen.
Der Allgemeinheit dürfte die Vehemenz der biotechnologischen Fortschrittsexplosion spätestens seit der Geburt der beiden ersten chinesischen CRISPR-Babys Ende letzten Jahres bekannt sein. Die revolutionäre Genschere CRISPR/Cas9 macht aus dem DNA-Strang einen wahren Legokasten. Für biologische Designer ist sie selbstredend essentieller Bestandteil ihres Werkzeugkastens.
Zu Ende gedacht...
Gründungen wie Ginko Bioworks arbeiten an nicht weniger als einer neuen industriellen Revolution: Einer organischen. Industrie 4.0: Das steht für die Vernetzung, Automatisierung und datenbasierte Steuerung industrieller Prozesse. Als nächstes könnte die Industrie 5.0 kommen: Biologie statt Technologie. Mit ihr werden völlig neue Formen und Spielarten industrieller Verarbeitung denkbar. Die Versprechungen der organischen Innovationen sind enorm. So manches getunte Bakterium leistet mehr als millionenteure Maschinen. Viele der größten Herausforderungen unserer Zeit lassen sich mit biologischen Erfindungen anpacken: Plastik, das sich selbst auflöst. Fleisch, das keine Nutztierhaltung erfordert. Mikroorganismen als Düngemittelersatz.
Werden wir die Chancen der biologischen Revolution nutzen? Oder wird die Republik die organische Industrie 5.0 verschlafen wie einst das Internet der Konsumenten? Es sieht mal wieder düster aus. Um die deutsche Chemieindustrie steht es nicht viel besser als um die heimische Automobilindustrie. Nicht nur VW, BMW und Daimler müssen sich neu erfinden, sondern auch Bayer, BASF und Konsorten. Da wäre die synthetische Biologie eine gigantische Chance. Doch leider gilt auch hier, was wir schon aus der digitalen Sphäre kennen: Die erfolgversprechendsten Start-ups finden sich in den USA und in China, nicht in Deutschland. Dazu kommen kulturelle Scheuklappen. Im Land des grünen Bürgertums ist Gentechnik Teufelswerk. Nicht gerade ein forschungsfreundliches Umfeld.
Auf politischer Seite besteht also Handlungsbedarf. Was beim digitalen Wandel viel zu spät kam, kann bei der Biotechnologie gerade noch rechtzeitig geschehen: Eine aktive Förderung und Steuerung des Fortschritts. Gefragt wäre eine Strategie für den Umgang mit einer völlig neuen Kategorie technologischer Innovationen. Ich fordere deshalb: Einen Biotechnologie-Masterplan für Deutschland. Für dessen Gestaltung sollten sich Regierung, pharmazeutische- und chemische Industrie sowie gesellschaftliche Interessenvertreter möglichst rasch an einen Tisch setzen. Es ist dringend Zeit für einen Bio-Gipfel. Action required!