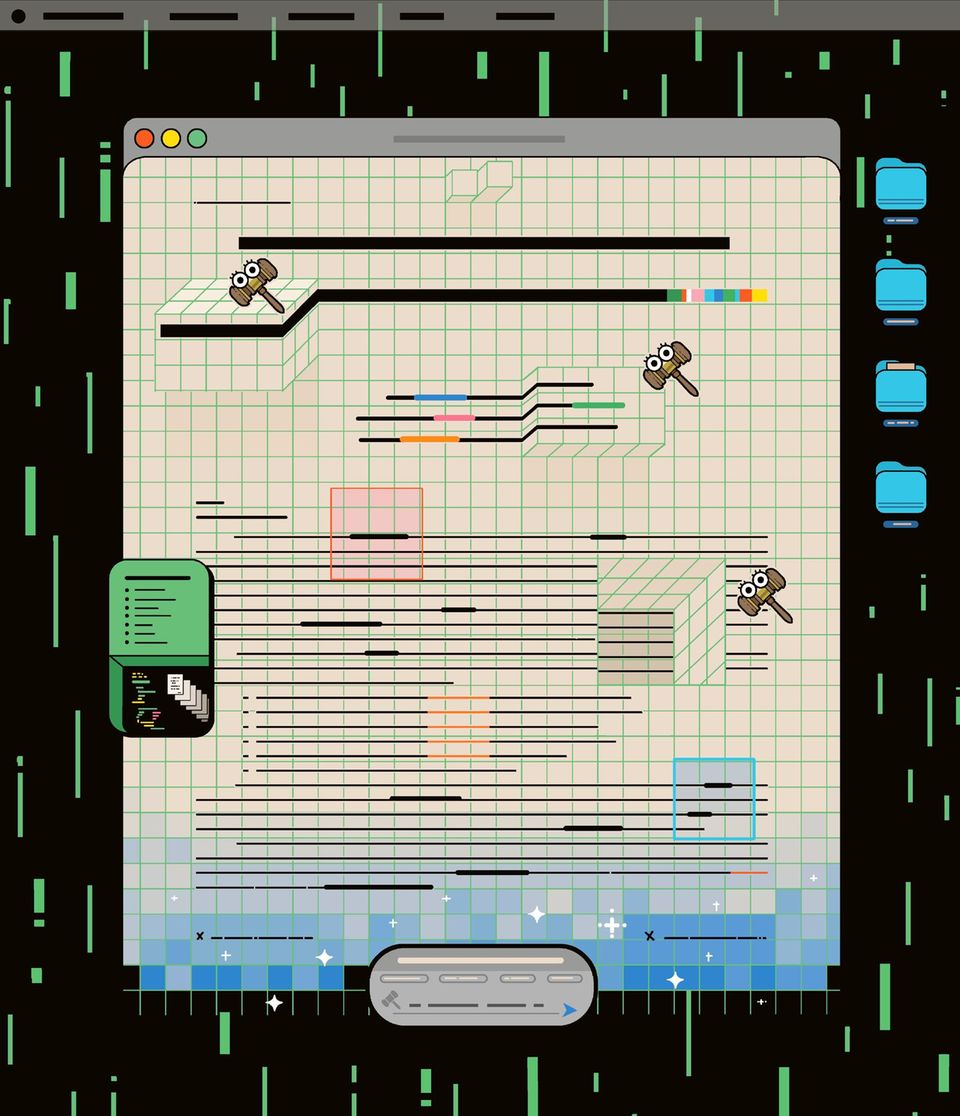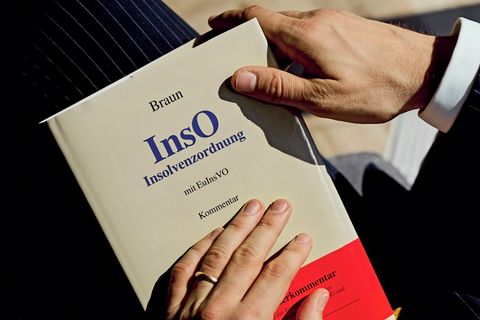Iusta ist schnell, verlässlich und genügsam. Wenn nötig, rackert sie auch mal eine 24-Stunden-Schicht durch, ganz ohne Essen und Trinken. Julius Reiter ist hochzufrieden mit seiner neuen Fachkraft im Dezernat Rechtsschutz. Sie arbeitet weg, woran der Anwalt früher sechs Sachbearbeiter gesetzt hat. Nun ist eine einzige Bürokraft einen halben Tag im Einsatz, den Rest erledigt Iusta, eine künstliche Intelligenz.
Wer Reiter in seiner Kanzlei am Berliner Hausvogteiplatz besucht, trifft auf einen quirligen Endfünfziger in weißen Turnschuhen, Pulli und Jackett. Den Kaffee serviert er selbst, das Wasser zapft er aus der Leitung. Seit der Gründung 2001 hilft die Kanzlei geschädigten Verbrauchern und Opfern bei Rechtsstreitigkeiten mit mächtigen Gegnern – „David-gegen-Goliath-Kämpfe, übertragen in den Gerichtssaal“ nennt Reiter das. Beim Loveparade-Unglück etwa haben Reiter und seine Kollegen die Angehörigen der Opfer vertreten, ebenso nach dem Absturz der Germanwings-Maschine in den französischen Alpen. Im festgefahrenen Streit zwischen der Bundesregierung und den Familien der israelischen Opfer des Olympia-Attentats von 1972 konnten sie jüngst einen Vergleich erzielen. 28 Mio. Euro haben sie rausgeholt, „hier an diesem Tisch“, erzählt Reiter. Unterstützt hat ihn dabei Gerhart Baum; der prominente FDP-Politiker und Anwalt ist seit vielen Jahren Seniorpartner der Kanzlei.
Dass Iusta existiert, liegt an einem Jahrhundertbetrugsfall mit Millionen Geschädigten. „Der Dieselabgasskandal brachte uns an Grenzen“, sagt Reiter. Bei Baum Reiter & Collegen landeten Tausende Fälle von VW-Fahrern, deren Autos so manipuliert worden waren, dass die Abgasreinigung auf der Straße abgeschaltet wurde. Alle hofften auf Entschädigung. Allein um mit den rund 120 Rechtsschutzversicherern die Kostenübernahme zu klären, benötigte Reiter ein halbes Dutzend Mitarbeiter. Denn jeder Versicherer hatte andere Verträge und Anforderungen – ein Riesenaufwand. Reiter testete Software, die diese Aufgabe übernehmen sollte. Weil ihn aber keine Lösung zufriedenstellte, setzte er selbst Entwickler an die Arbeit. Als Spin-off gründete Reiter 2019 die Legal-Tech-Firma Iusta. Deren gleichnamige Software schickt nun automatisch die passenden Schreiben an die Versicherer. Sie weiß sogar, welches Oberlandesgericht im Dieselfall wie entschieden hat, und passt Schriftsätze entsprechend an. Noch schreibt die KI die Klageschrift nicht selbst, „doch ihre Lernkurve ist steil“, sagt Reiter.
Der Robo-Anwalt ist nicht mehr fern
Mit seiner Kanzlei zählt er zu den KI-Vorreitern in der Rechtsberatung. Die Branche ist gerade dabei, den Nutzen der Technik zu entdecken. Anwälte experimentieren mit KI, um Prozesse zu optimieren, Verträge zu erstellen oder juristische Datenbanken nach Referenzfällen zu flöhen. Anwälte, die nur noch überwachen, was die KI entscheidet, klingen wie Science-Fiction, könnten aber schon bald Realität werden.
Capital hat bei Wirtschaftsanwälten für Privatmandanten nachgehakt, ob und wo sie bereits KI einsetzen und wie Verbraucher davon profitierten. Die ausgewählten Kanzleien gehören alle zu den besten ihres Fachs, ermittelt im Rahmen einer deutschlandweiten Befragung von Capital, „Stern“ und dem Marktforschungsinstitut Statista (mehr zur Methodik s.u.).
Einer davon ist Klaus Lützenkirchen, groß gewachsen, Bürstenhaarschnitt, Schnauzbart. Er ist seit 1986 im Geschäft, ein Original der Anwaltsszene – und er kennt alle Mietrechtsparagrafen aus dem Effeff. Bei Mahnsachen, Ärger um Schönheitsreparaturen oder Betriebskostenabrechnungen macht dem Kölner Rechtsanwalt so leicht keiner was vor. Aber neulich verblüffte ihn dann doch eine KI. Lützenkirchen hatte als Vorbereitung für einen Vortrag ChatGPT mit ein paar Stichworten gefüttert und einem BGH-Urteilskürzel. „Es kam ein Text dabei heraus, der genau das enthielt, was ich den Leuten erzählen wollte.“ Zwar schafft es die KI nicht, seinen rheinländischen Singsang zu imitieren und die Begeisterung, mit der er spricht. Aber sie konnte die Leitsatzentscheidung gut deuten und einordnen.
Noch nutzt Lützenkirchen das Programm nicht in seiner Kanzlei, aber seit dem Experiment kann er sich gut vorstellen, KI dafür einzusetzen, „schematische Schriftsätze zu generieren“, etwa Mahnbescheide, weil ein Mieter nicht gezahlt hat. Künstliche Intelligenz könnte ihm auch bei der Recherche helfen: Welche Urteile haben Gerichte in ähnlichen Fällen gefällt? In fast 40 Jahren im Mietrechtsbusiness hat er zwar schon Hunderte Urteile gehört oder selbst erstritten, aber niemand kann sich die alle merken. Und keine Datenbank spuckt bisher automatisch alle passenden Fälle aus. Er freut sich, wenn KI ihn künftig entlastet. „Wir sind froh um jede Minute, die wir für Mandantengespräche oder den Austausch mit Kollegen haben.“
Die KI lässt sich nicht verklagen
Lukas Kemperdiek, Spezialist für Versicherungs- und Verkehrsrecht bei Advomano in Hagen, dämpft die Erwartungen etwas: „Für die echte Aktenarbeit ist ChatGPT noch nicht fit genug“, findet er. Frage man die KI danach, ob schon eine BGH-Entscheidung zum Fall XY vorliege, laute die Antwort manchmal Nein, obwohl bereits Urteile gefällt wurden. Manchmal bejahe der Chatbot die Frage, spucke aber unpassende Urteile aus. „Einmal erfand er einfach ein Urteil samt Aktenzeichen“, berichtet Kemperdiek.
Wegen solcher „Halluzinationen“ hagelte es jüngst in den USA und Kanada Ermahnungen an Anwälte, generative KI sorgfältiger einzusetzen. Mal hatte ein Anwalt eine von ChatGPT generierte „nicht existente“ Behörde zitiert, Ex-Trump-Anwalt Michael Cohen musste kleinlaut einräumen, in einem Schriftsatz fiktive Fälle verwendet zu haben. Inzwischen verlangen erste US-Gerichte, dass der Einsatz von KI angezeigt werden muss. Auch in Deutschland dürfte es so kommen.
Baurechtsanwalt Marcus Hirschfelder von der Kanzlei Gessner aus Saarbrücken hält KI für keine „verlässliche Autorität“. Fälle und Entscheidungen lese er lieber selbst – schon aus Haftungsgründen. Die KI könne er nicht verklagen, wenn was schieflaufe. ChatGPT sei „brauchbar in einfach gestrickten Fällen“. Aber das private Bau- und Architektenrecht, seit 1972 Schwerpunkt der Kanzlei, sei zu komplex. Das meiste erfordere „Hand- und Kopfarbeit“, die die KI bisher noch nicht leisten könne. Größere Einsatzmöglichkeiten sieht er im öffentlichen Baurecht: Anträge und Baugenehmigungen könnten gut automatisiert werden. Dafür aber müssten die Behörden erst mal die Digitalisierung hinkriegen.
Für Andreas Koenen ist ChatGPT eine Quelle der „Inspiration“. Der Anwalt lässt die KI etwa einen Schriftsatz des Gegners analysieren und Gegenargumente finden. In seiner Baurechtskanzlei teilen sie Prompts auf einer Plattform. Seine Erfahrung: Die KI sei sehr gut darin, Entscheidungen zusammenzufassen und einzuordnen. Der Anwalt ist überzeugt davon, dass bald kein Mandant mehr bereit sein wird, für Arbeiten zu zahlen, die künstliche Intelligenz besser und schneller erledigen kann als ein Mensch. In den USA würden Rechercheleistungen bereits von der Rechnung gestrichen.
Nützlich könnten die Programme bei der Suche nach Signalbegriffen in großen Aktenmengen sein. Versicherungsrechtler Kemperdiek hält es etwa für möglich, damit aus einer Fülle von Arztberichten das Krankheitsbild eines Mandanten zu ermitteln, um Ansprüche gegen eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuleiten. Zwar könne das generell auch jede studentische Hilfskraft erledigen, die benötige dafür jedoch ungleich mehr Zeit.
Bis solche Programme regelmäßig in Kanzleien eingesetzt würden, werde es allerdings noch Jahre dauern, glaubt er. Viele Fragen seien zu klären: Welche Abläufe sollen von einer KI übernommen werden? Habe ich die Mitarbeiter, die solche Programme bedienen können? Welche Datenschutzvorgaben gilt es zu beachten? Und wer überprüft später, ob die KI-generierten Ergebnisse richtig sind? „Mit dem Druck auf einen Knopf ist ja nicht die ganze Arbeit erledigt“, so Kemperdiek.
So mancher Rechtsstreit ließe sich durch automatisierte Programme womöglich ganz verhindern. „Da wird Anwälten irgendwann viel Geschäft verloren gehen“, sagt der Versicherungsrechtler. Momentan aber passten die Ergebnisse der KI oft nicht zur gängigen Rechtsauffassung. Wenn es zum Beispiel darum geht, grundsätzlich zu entscheiden, ob eine Versicherung zahlen muss oder nicht, kommen Mensch und Maschine häufig zu unterschiedlichen Einschätzungen.
Und wesentliche Fragen können selbst die intelligentesten Bots nicht beantworten: jene nämlich, bei denen es um Leib und Leben geht. „Vor allem im Medizinrecht haben wir schon sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht“, sagt Kemperdiek. „Natürlich kann man sich eine Patientenverfügung mithilfe der KI aus Textbausteinen zusammenbauen. Aber es ist streckenweise problematisch, was dabei herauskommt.“ Manche Fragen lassen sich eben nur von Menschen beantworten: Wann sollen medizinische Geräte im Notfall abgestellt werden? Wie soll das Aufenthaltsrecht eines minderjährigen Kindes geregelt sein, wenn den Eltern etwas zustößt? „Immer wenn emotionale oder moralische Komponenten hineinspielen, ist es keine gute Idee, sich auf künstliche Intelligenz zu verlassen“, mahnt Kemperdiek.
Chatbot verfasst den Letzen Willen
Das würde auch Claus Henrik Horn unterschreiben, in dessen Tagesgeschäft es um genau solche Fragen geht: Er ist Erbrechtsanwalt aus Düsseldorf und auf Fälle spezialisiert, in denen Patchworkfamilien um die gerechte Erbfolge streiten oder Unternehmererben gegen ihre Entmachtung. „Zuerst dachte ich, mich als Spezialisten betrifft der KI-Hype nicht“, erzählt Horn, „aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele Menschen in Zukunft KI-Anwendungen nutzen werden, um damit selber ihre Testamente zu erstellen. Auf bestimmte Stichworte hin kann die KI schon die üblichen Klauseln formulieren.“
Er begrüßt das doppelt: einerseits, weil viele Menschen kein Testament hinterlassen – was häufig zu Erbstreitigkeiten führt. KI könnte dafür sorgen, dass der Letzte Wille häufiger ausformuliert wird. Andererseits, weil das seiner Zunft vermutlich noch mehr Mandanten beschert: „Häufig wird das Ergebnis so ausfallen, wie es gar nicht gewollt war.“ Welche verschiedenen Auslegungen Klauseln erlauben oder welche Auswirkung das Einsetzen eines Erben auf die gesamte Vermögensverteilung haben kann, das kann oft nur ein erfahrener Anwalt beantworten. Der kann auch dafür sorgen, dass sich ein Testament durch Änderungsklauseln anpassen lässt, falls sich die Familienverhältnisse ändern.
Verbraucherschutzanwalt Reiter in Berlin ist überzeugt davon, dass KI juristische Recherchen künftig auf Knopfdruck liefert und Anwälte von zahlreichen Verwaltungsaufgaben befreit. „Wir können dann viel besser auf den Punkt arbeiten.“ Seinen Kanzleistar Iusta nutzen inzwischen viele andere Unternehmen in Lizenz. In seine Legal-Tech-Firma holt er gerade Investoren, um Iusta „einen Innovationsschub zu geben“. Schließlich gibt es noch unglaublich viel Rechtsarbeit, die sich automatisieren lässt.
So läuft die Abstimmung
Wer einen guten Anwalt sucht, erwartet Kompetenz, Reputation und einen vertrauensvollen Umgang. Diese Studie, die das Marktforschungsinstitut Statista jährlich gemeinsam mit Capital und dem „Stern“ erhebt, soll dabei helfen, den passenden Rechtsexperten zu finden. Mittels einer breit angelegten Befragung wurden zum fünften Mal die besten Kanzleien für Privatmandanten ermittelt. Sieben Rechtsgebiete werden in Capital abgebildet, weitere fünf lassen sich im „Stern“ nachlesen. Auf capital.de/rechtsanwaelte können gezielt Fachleute nach Rechtsgebieten und Regionen gesucht werden.
Die Methode
Juristen können die Qualität ihrer Kollegen am besten einschätzen und wissen, auf wen Verlass ist und wer vor Gericht das meiste für seine Mandanten herausholt. Für die Studie in diesem Jahr wurden 30.622 Rechtsanwälte eingeladen, an einer Onlineumfrage teilzunehmen, die vom 4. Oktober bis zum 1. Dezember 2023 lief.
Die Entscheidung
Pro Fachbereich konnten die Rechtsanwälte bis zu zehn Empfehlungen für Kanzleien abgeben. Eigennennungen waren tabu. Insgesamt 3791 Teilnehmer gaben ihr Votum ab. Auf die Bestenliste schafften es nur Kanzleien, die überdurchschnittlich häufig von Kollegen empfohlen wurden. Kanzleien mit nur wenigen Empfehlungen wurden dagegen nicht aufgenommen. Dies stellt keine Qualitätsaussage über Kanzleien dar, die nicht in der Liste vertreten sind. Je nach Rechtsgebiet sind die Bestenlisten unterschiedlich lang. Unterteilt wurden die Aufstellungen in regional und überregional vertretene Kanzleien.
Über Statista
Statista veröffentlicht regelmäßig weltweit etablierte Rankings und Unternehmens-Toplisten mit hochkarätigen Medienpartnern. Das führende Daten- und Business-Intelligence-Portal bietet Statistiken, geschäftsrelevante Daten und zahlreiche Markt- und Verbraucherstudien.
Das Gütesiegel
129 Kanzleien erhalten diesmal eine Topbewertung und können ein Siegel lizenzieren. Die Aufnahme in die Bestenliste ist unabhängig vom Erwerb des Siegels. Genauere Informationen zu den Bedingungen finden Sie unter capital.de/siegel.