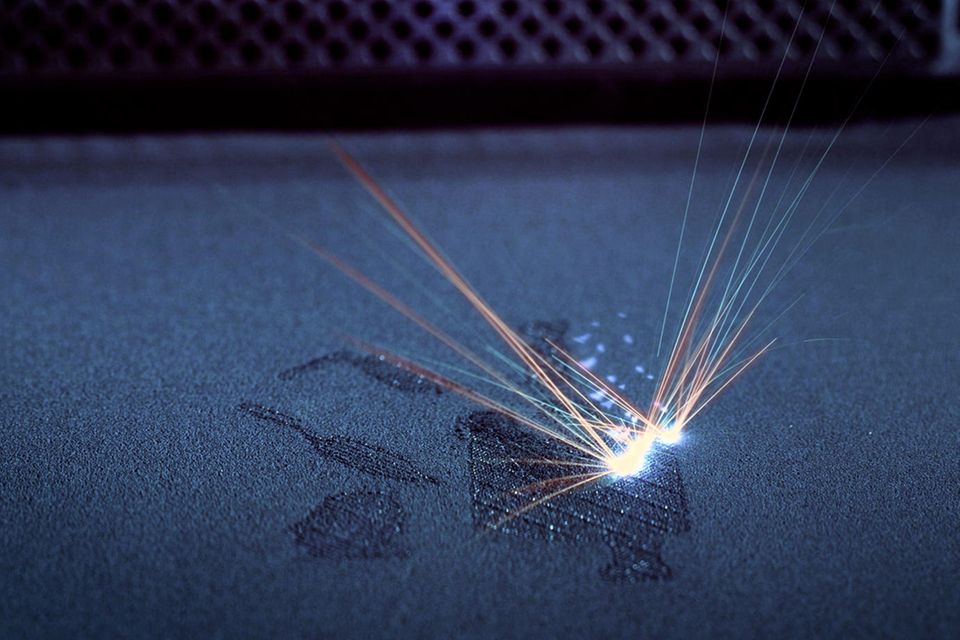Wer HHLA Next besucht, begibt sich zunächst nicht in die Zukunft, sondern in die Vergangenheit: Simone Lode, die die Innovationseinheit der Hamburger Hafen und Logistik AG leitet, empfängt in einem altehrwürdigen Gebäude in der Speicherstadt – einem backsteinernen Ort, der für alte Transportwege steht, für schwere Waren, die verstaut und verladen werden. Früher machte man sich hier nur wenig Gedanken über Abgase und Schadstoffe, solange Schiffe, Lastwagen und Züge verlässlich Nachschub lieferten. Dieser Ort soll nun Ausgangspunkt für etwas Neues werden: HHLA Next will dem Hafenbetreiber dabei helfen, sich von den CO₂-Emissionen so rasch wie möglich zu verabschieden. „Wir verstehen Digitalisierung und Dekarbonisierung als zentrale Aufgabe für uns“, sagt Lode, eine energische Frau, die den Eindruck erweckt, dass ihr die Dinge selten schnell genug gehen.
Diesen Satz hört man so oder ähnlich in fast allen Ideenschmieden der deutschen Wirtschaft: Welches Ziel sie auch immer verfolgen – Digitallabore, Innovation Units oder Venture Builder –, überall entwickeln diese Einheiten Lösungsansätze für ein Problem, das Konzerne wie Mittelständler gleichermaßen betrifft: Sie müssen runter mit den Emissionen, nicht nur aus Imagegründen, sondern auch, weil durch Vorgaben der Europäischen Kommission die Kosten in die Höhe schießen. Die Innovationsteams, die früher oft unklar umrissene „neue Geschäftsfelder“ aufspüren sollten, haben eine klare und konkrete Aufgabe bekommen, deren Ergebnis sich in Euro bemessen lässt. „Wir investieren strategisch, mit dem Fokus, auch einen Beitrag für das Kerngeschäft zu leisten“, sagt Lode.
Als die aktuelle Studie zu deutschen Digitallaboren aufgelegt wurde, die Capital in diesem Jahr bereits zum siebten Mal mit der Hamburger Beratung Infront Consulting & Management umsetzt, war klar, dass der Fokus diesmal darauf liegen soll, wie die Einheiten Unternehmen mithilfe digitaler Methoden nachhaltiger machen. Getestet wurden wieder Teams von Unternehmen im deutschsprachigen Raum, die selbst innovative Projekte vorantreiben, Ausgründungen unterstützen oder den Markt nach Start-ups abgrasen.
Der Begriff „Nachhaltigkeit“ wurde in drei Richtungen gedeutet: Es ging um Beiträge zum Abbau von Umweltbelastungen, zur gesellschaftlichen Entwicklung und zur langfristigen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens. Diese Kriterien spiegeln sich in den Kategorien „Menschen“, „Planet“ und „Gewinn“, die jeweils bewertet wurden.
Insgesamt 39 Labore beteiligten sich in diesem Jahr an der Studie und durchliefen ein zweistufiges Verfahren: Zunächst mussten die Leiterinnen und Leiter Fragebögen ausfüllen, in denen sie Ziele und Projekte vorstellen (zur Methodik siehe unten). Die Einheiten, die sich für eine zweite Runde qualifizierten, wurden dann in einem persönlichen Interview geprüft. Bewertet wurde in drei Branchengruppen: Handel und Dienstleistungen, produzierende Unternehmen sowie Transport und Infrastruktur.
Elektrisch durch den Hafen
Teilgenommen haben in diesem Jahr Innovationsteams von Konzernen wie Bosch, Commerzbank oder Lufthansa, aber auch Ableger kleinerer Unternehmen. Manche Einheiten sind schon zum dritten oder gar vierten Mal dabei, andere sind Neulinge. Trotz des heterogenen Teilnehmerfelds zeigt sich ein klarer Trend: Nachhaltigkeit, in vielen Unternehmen lange ein belächeltes Feld für die hinteren Seiten im Geschäftsbericht, ist zur zentralen Aufgabe für alle geworden, die etwas wirklich Neues entwickeln wollen. Zu den wichtigsten Erkenntnissen, die Studienautorin Lea-Theresa Münch gewonnen hat, zählt diese: „Die besten Effekte werden dann erzielt, wenn das Unternehmen Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammen denkt.“
Bei HHLA Next in Hamburg, die in der Branche Transport und Infrastruktur gut abschnitt, zeigt sich das bei vielen Projekten. Ein Beispiel ist OnePort5, eine Plattform, die eine Ladeinfrastruktur für batteriebetriebene Lkw-Sattelzugmaschinen ermöglichen soll. „Ich hätte gerne noch zehn weitere Ideen, die Digitalisierung und Dekarbonisierung so zusammenbringen“, sagt HHLA-Next-Chefin Lode. Für alle Beteiligten entstehe „ein wirtschaftlicher Vorteil und ein positiver Effekt auf die eigene CO2-Bilanz“.
Völlig anders gelagert, aber von ähnlichen Motiven getrieben, ist ein Projekt, an dem sich BSH Startup Kitchen beteiligt hat, eine Innovationseinheit der Bosch-Gruppe. Das Unternehmen investierte in Tulu, ein US-amerikanisches Start-up, das Hausgeräte wie Staubsauger oder Akkubohrer, aber auch Virtual-Reality-Headsets über ein spezielles Modell vermietet: In den Fluren und Eingangsräumen großer Wohnanlagen oder Studentenheime werden Schränke mit Geräten gestellt, die sich per App anmieten lassen. Für den Bosch-Ableger ist das ein neues Geschäftsmodell für eine Generation, in der angeblich weniger Wert auf Besitz gelegt wird. Zugleich werden die eigenen Geräte auf diese Art einer Härteprüfung unterzogen: „Das ist auch ein Weg, unsere Produkte im Rahmen einer intensiven Nutzung zu testen“, sagt Lars Rössler, Leiter von BSH Startup Kitchen. „Als ich Tulu zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich: Warum sind wir nicht selbst darauf gekommen?“
Solche Beispiele zeigen, wie neue Entwicklungen mit dem Ziel verbunden werden können, Ressourcen effizienter zu nutzen. „Die es gut machen, sind Überzeugungstäter“, sagt Studienautorin Münch. „Und wenn man es richtig anstellt, kommt auch Geld dabei heraus.“
Beim Thema Nachhaltigkeit geht es neben der Umwelt auch um den Faktor Mensch. Der Fall FNX zeigt, wie Innovationslabore auch diesen Aspekt für ein Geschäftsmodell nutzen können: Der Ableger des Tierbedarfhändlers Fressnapf versucht, das Unternehmen vom reinen Warenverkäufer zum Dienstleister weiterzuentwickeln und hat dafür einen Telemedizinservice für Haustiere entwickelt. Da außerhalb von Großstädten Veterinäre oft weit entfernt sind, sollen die Tierhalter ihren Fall so rascher einem Mediziner vorstellen können. Das Unternehmen hat dafür nicht nur eine Plattform aufgebaut, sondern beschäftigt auch eigene Tierärzte, die zu Zeiten erreichbar sind, in denen keine Praxis mehr geöffnet hat.
Generation Z als Antreiber
Deutlich schwerer tut sich FNX beim Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit. Große Haustiere wie Hunde oder Katzen sind nun mal Fleischfresser, und der CO₂-Effekt der Futterproduktion ist entsprechend groß. Doch auch hier versucht das Innovationslabor, Neues auszuprobieren – indem es mit Ersatz für Fleisch in der Tiernahrung experimentiert. „Perspektivisch können wir so einen sehr großen Effekt für die CO₂-Reduktion haben“, sagt der Leiter der Einheit, Jens Pippig.