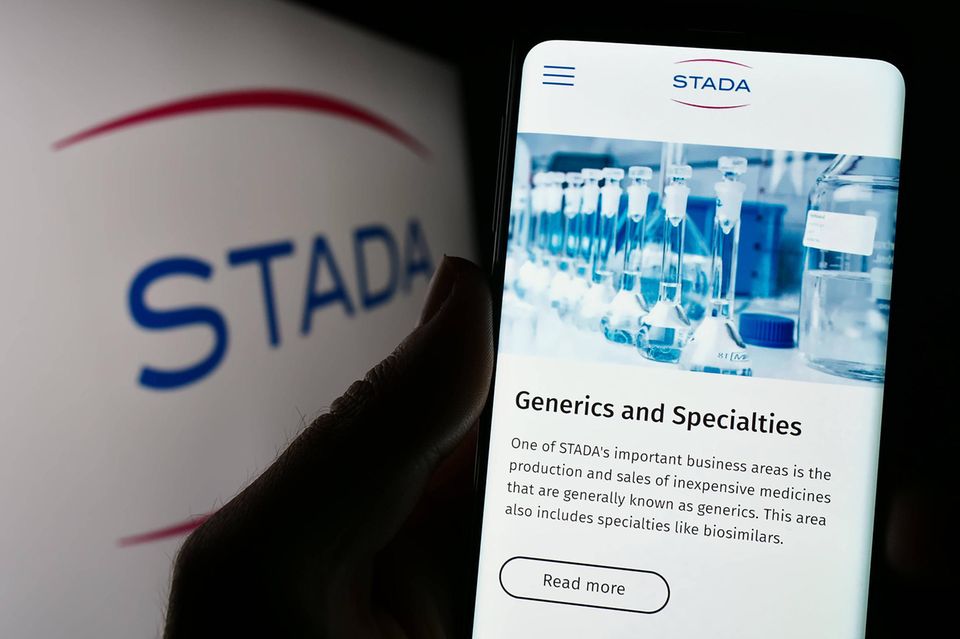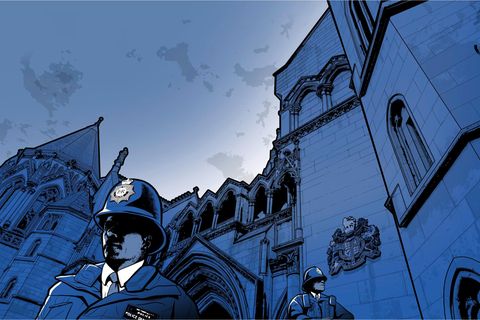Wenige Tage nach der De-facto-Enteignung betrachtet sich der französische Lebensmittelkonzern Danone zwar weiter als rechtmäßiger Besitzer seiner Russland-Tochter. Trotzdem erhöhte er seine Abschreibungen aber auf 700 Mio. Euro. Die Beschlagnahme der Geschäfte von Danone und des dänischen Bierbrauers Carlsberg sind – nach den Energiefirmen Fortum und Uniper im April – der vorläufige Höhepunkt von Präsident Wladimir Putins Schikanen gegen Firmen aus „feindlich gesinnten“ oder „bösen Staaten“. Offenkundig will Putin ausländische Konzerne noch stärker in Geiselhaft nehmen als bisher.
Nach einer Meldung der „Moscow Times“ unter Berufung auf Interfax und einen unveröffentlichten Entwurf eines bevorstehenden Präsidialdekrets will der Kreml sich „superprioritäre“ Vorgriffsrechte auf die Vermögen von „strategischen“ Unternehmen sichern, die das Land verlassen wollen. Die Liste strategischer Konzerne umfasse 200 Firmen, hieß es Mitte dieser Woche, darunter der Lebensmittelriese Danone und und der finnische Energiekonzern Fortum.
Moskau kreist damit ausländische Unternehmen, die noch im Land sind, ihre Aktivitäten aber zurückfahren oder einstellen wollen, weiter ein. Schon seit Dezember müssen verkaufswillige Unternehmen einen 50-prozentigen Abschlag auf den Verkaufswert hinnehmen und zudem eine Rückzugsgebühr von mindestens zehn Prozent des Preises entrichten. Der Kreml suche nach Geldquellen, sagen Experten, und Vermögenswerten, mit denen unzufriedene Verbündete Putins bedacht werden könnten.
Der Auswärtige Dienst der EU reagierte mit der deutlichen Warnung, Russland sei für ausländische Investoren nun vermintes Terrain. „Das Präsidialdekret ist ein weiterer Beweis für Russlands Missachtung von internationalem Recht und Regeln“, sagte ein Sprecher dem Infodienst „EUobserver“. Nun seien wirtschaftliche Interessen von rechtmäßig tätigen Firmen das Ziel. So plündere Russland nicht nur die Ukraine, sondern gehe dazu über, „Eigentümern auf russischem Territorium illegal die Kontrolle über ihr Vermögen zu entziehen". Es werde damit auch in wirtschaftlicher Hinsicht „vollkommen unsicher und unberechenbar“.
Weitere Opfer?
Aus Sicht von Professor Jeff Sonnenfeld von der Yale School of Management müsse westlichen Unternehmen, die auch im zweiten Jahr von Putins Feldzug gegen die Ukraine in Russland Geschäfte machten, das Risiko der Enteignung bewusst sein. Die Fakultät verfolgt und veröffentlicht das Verhalten internationaler Investoren seit dem völkerrechtswidrigen Angriff im Februar 2022. Mehr als 1.000 ausländische Firmen verabschiedeten sich demnach 2022 aus Russland, rund 600 blieben.
Sonnenfeld rechnet nun mit weiteren Opfern, denen eine „Strafe“ des Kreml bevorstehe – dafür, dass sie (wie Danone und Carlsberg) seit einiger Zeit ihren Rückzug vorbereiteten. Unilever, Benetton oder Pepsi könnten die nächsten sein. Unternehmen, die ihr Russlandgeschäft aus Furcht vor Einbußen bisher nicht aufgeben wollten, dürften die Dekrete umgekehrt davon abhalten, doch zu gehen.
Obwohl aus Sicht Sonnenfelds jede verbleibende Firma ihre russischen Aktiva abschreiben und von dannen ziehen sollte – statt den Kreml zu bereichern. Nach Berechnungen der Kiew School of Economics (KSE) in der Ukraine zahlten allein EU-Firmen in Russland 2022 mindestens 530 Mio. Euro Steuern auf Gewinne. Von den deutschen Unternehmen, die vor dem Krieg in Russland tätig waren, sind demnach 69 Prozent geblieben – und steuerten mit 400 Mio. Dollar – nach den US-Firmen – den zweithöchsten Betrag an Moskau bei.
Capital gibt einen Überblick über führende deutschen Firmen und ihr Russlandgeschäft. Die Mehrheit ist geblieben und verdient gutes Geld:
Deutsche Unternehmen in Russland
Mit AO Bayer in Moskau sind in Russland alle Sparten des Konzerns vertreten: Gesundheit, Arzneimittel und Landwirtschaft. Die Produkte werden seit Kriegsbeginn weiter vertrieben. Vorstandsmitglied Rodrigo Santos nahm in einem Interview die Haltung ein, ein Exportstopp werde nicht helfen, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Bayer habe alle Aktivitäten in Russland und Weißrussland ausgesetzt, die nicht im Zusammenhang mit der Bereitstellung von lebenswichtigen Gesundheits- und Agrarprodukten stünden. „Dabei handelt es sich um unentbehrliche Arzneimittel und Produkte für die Zivilbevölkerung – Verbraucher und Landwirte –, die gemäß dem G7-Abkommen dorthin geliefert werden können.“
Die auf Fabrikautomation, Hydraulik und Elektrifizierung spezialiserte Bosch Rexroth hat nach Firmenangaben in Russland ihr Geschäft im Lauf des vergangenen Jahres komplett eingestellt. Unklar ist, wie weit der gesamte Technologiekonzern Bosch mit dem geplanten Verkauf seiner Werke unweit St. Petersburg fortgeschritten ist. Laut der russischen Wirtschaftszeitung Kommersant hat die chinesische Firma Hisense, die weltweit gemeinsame Projekte mit Bosch entwickelt, „die günstigste Rückkaufoption angeboten für den Fall, dass Bosch auf den russischen Markt zurückkehren möchte“. Einige Vermögenswerte und Niederlassungen sollen auch an die Holding S8 Capital gegangen sein. Zuletzt habe Bosch in Russland knapp 500 Mio. Dollar umgesetzt.
Der Landtechnikhersteller Claas unterhält im russischen Krasnodar ein eigenes Werk und beschäftigte dort mehr als 2000 Menschen. Nach einer juristischen Untersuchung von Techniklieferungen an das Werk sah Claas sich vom Vorwurf des Sanktionsbruchs im vergangenen Jahr entlastet. Nach Medienberichten soll das Familienunternehmen durch die Lieferung bestimmter Bauteile für Mähdrescher versucht haben, die EU-Ausfuhrbeschränkungen zu unterlaufen. Landwirtschaftliches Gerät ist von den westlichen Sanktionen ausgenommen. LeaveRussia.org beziffert den Umsatz auf 515 Mio. Dollar. Nach einer jüngeren Mitteilung von Claas sei das Werk heruntergefahren worden.
Die bayrische Molkerei Ehrmann aus dem Landkreis Unterallgäu fällt in die Gruppe der Lebensmittel- oder Süßwarenhersteller, die – wie auch Storck –, unabhängig von Putins Kriegsverbrechen einfach weiter Gewinne machen wolle, wie es ein Experte formuliert. Ehrmann hat zuletzt laut Kiew School of Economics (KSE) mit 470 Mio. Dollar ein großes Umsatzplus in Russland erzielt. Die Zahl der Beschäftigten in der russischen Niederlassung liegt über 1.000. Auf neue Investitionen in Putins Reich wollte man nach der Übernahme von Friesland Campina vor dem Krieg vorerst verzichten. Storck steigerte den Umsatz laut KSE um 50 Prozent auf 162 Mio. Dollar.
2016 veranstaltete Metro noch eine Messe-Show mit Starköchen, Bankenchefs und Politikern. An Lukrativität hat der Großhandel mit Konsumgütern auch in Kriegszeiten nicht eingebüßt. Metro erzielte in Russland der Kiew School of Economics zufolge 2022 Erlöse von mehr als 3 Mrd. Dollar – etwa gleichauf mit Danone – und gehörte zu den zehn umsatzstärksten Töchtern internationaler Unternehmen. Der Imageschaden für den börsennotierten Konzern scheint überschaubar. Metro will in Russland bleiben und begründet das mit einem bedeutenden Teil des Umsatzes, der Verantwortung für 10.000 Mitarbeiter im Land und damit, die Zivilbevölkerung zuverlässig mit Lebensmitteln versorgen zu wollen.
Die SB-Warenhauskette Globus hat in russischen Filialen vom starken Umsatz von Alkohol und Tabakwaren profitiert. Die Holding, zu der Super-, Bau- und Elektronikmärkte gehören, beschäftigt in Russland fast 10.000 Mitarbeiter und macht laut KSE 14 Prozent ihres Umsatzes in Russland. 2022 waren das 1,2 Mrd. Dollar. Das Management für das Märktenetz in Russland sitzt in Prag. Die Begründung für das fortgesetzte Russlandgeschäft gleicht der von Metro.
Die Betonmischer vor der Firmenzentrale tragen das neue Logo der Heidelberg Materials. Im Bauwesen betreiben die Heidelberger in Russland drei Zementwerke, die drei Prozent zum Konzernumsatz beisteuern. Von Rückzug ist keine Rede. Die Werke werden „in Russland auf kleiner Flamme“ weitergefahren, heißt es. Es sei ein lokales Geschäft, die Investitionen habe man komplett eingefroren. Das Unternehmen beteuert, sich an alle Sanktionen der Bundesregierung und der EU zu halten. Vom Russland-Geschäft wurden laut Finanzchef Ende 2022 gut 100 Mio. Euro abgeschrieben. In der Bilanz stehe das Geschäft noch mit 150 Mio. Euro.
In Sotschi empfing Präsident Putin 2019 deutsche Unternehmer, darunter den Chef der Knauf-Holding Manfred Grundke (r.). Russland ist für den Gips-Weltmarktführer einer der wichtigsten Märkte, in den er jahrelang in Milliardenhöhe investiert hat. Nach KSE-Angaben hat das Trockenbauimperium in Russland zuletzt an 14 Standorten rund 1,2 Mrd. Dollar umgesetzt und hält in diesem Volumen auch Vermögenswerte. 4900 Beschäftigte arbeiten für das Unternehmen in Russland. Knauf erklärte bereits kurz nach Kriegsbeginn, sein Geschäft fortsetzen zu wollen, hat aber die Neuinvestitionen zurückgestellt.
Der Kran- und Baggerhersteller mit offiziellem Sitz in der Schweiz betreibt in Russland Produktionsgesellschaften und eine Vertriebsgesellschaft mit über 30 Service- und Support-Niederlassungen in allen Regionen. Der Konzern verkündete, man wolle die „bestehenden Verträge“ in Russland im Rahmen des gesetzlich Zulässigen weiter honorieren. Ansonsten bleibt es beim Stopp einiger Invesitionen und Aktivitäten. Liebherr wurde zuletzt für seine Partnerschaft mit dem Kamas-Konzern kritisiert, einem Hersteller von Lkw und Militärgerät, der auf der US-Sanktionsliste steht. Laut KSE wurden zuletzt in Russland 534 Mio. Dollar eingenommen und 1400 Menschen (2021) beschäftigt.
Für den bekannten Schokoladenhersteller Ritter Sport ist Russland weiter der stärkste Absatzmarkt im Ausland. KSE beziffert den dortigen Umsatz mit knapp 110 Mio. Dollar. Demnach wurde in dem Jahr nach Beginn des Ukrainekriegs doppelt so viel Schokolade verkauft wie im Vorjahr. Neuinvestitionen legte Ritter Sport auf Eis – verbunden mit dem Versprechen, alle Gewinne aus dem Russlandgeschäft für humanitäre Zwecke zu spenden. Aber um Jobs und Existenzen von Kakaobauern zu sichern, solle der Markt nicht aufs Spiel gesetzt werden.
Stada gehört – wie Fresenius – zur Gruppe der Hersteller von medizinischen Geräten und Medikamenten, die sich aus ethischen Gründen gegen einen Rückzug sperren, aber Umsätze gerne mitnehmen. In Russland setzte Stada 2021 mit neun Niederlassungen und mehr als 2000 Mitarbeitern rund 674 Mio. Dollar um. Laut den Informationen von LeaveRussia.org diskutieren Behörden in Russland über eine Sonderabgabe von 220 Prozent auf Nahrungsergänzungsmitteln aus Unternehmen „böser Länder“, die auch Stada betreffen könnte. Fresenius hatte demnach einen Umsatz von 240 Mio. Euro und 1500 Mitarbeiter, Fresenius Medical Care unterhält zudem tausende Dialysezentren.
Der Maschinenbaukonzern mit Sitz in Ditzingen bei Stuttgart ist mit Niederlassungen in der ganzen Welt vertreten – auch in Moskau. Die Yale School of Management führt ihn in der Kategorie „Business as usual“. Jedoch hat Trumpf nach Kriegsbeginn die Geschäftsbeziehungen mit Russland eingestellt, wie es hieß, wozu auch ein Lieferstopp für Ersatzteile und ein Baustopp an einer Niederlassung gehörten. Der russische Markt trug nach Firmenangaben mit rund 35 Mio. Euro weniger als ein Prozent zum Gesamtumsatz bei. Für 2023 wird mit noch 30 Beschäftigten ein Kompletteinbruch erwartet.