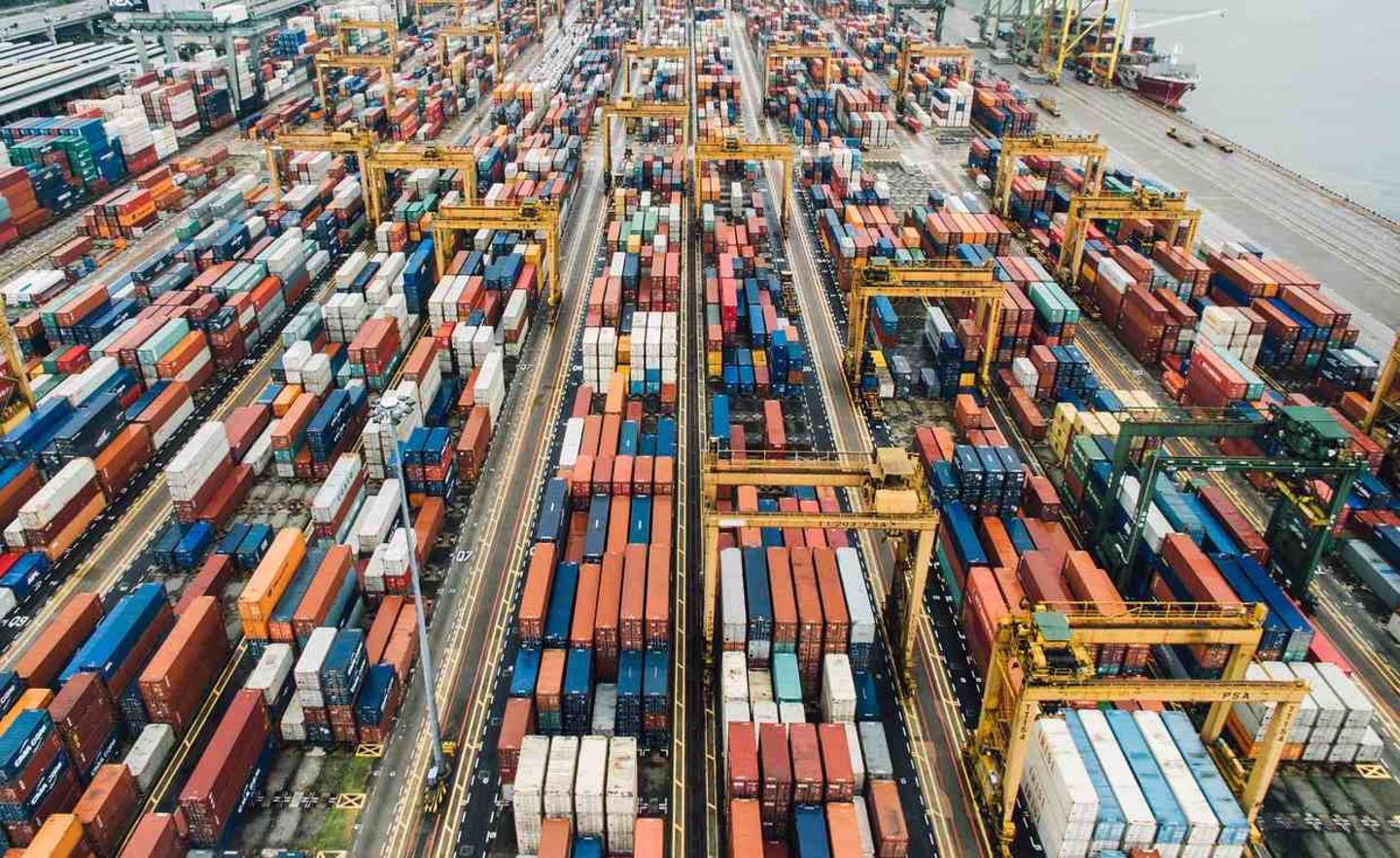Am 14. November gibt das Statistische Bundesamt die offizielle Schätzung für das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal bekannt. Schon jetzt rechnen einige Beobachter erneut mit einem Minus . Auch die Prognosen im Jahresgutachten des Sachverständigenrates der Bundesregierung sehen düster aus: Für 2019 rechnen die sogenannten Wirtschaftsweisen mit einem Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent. Im Umgang mit dem Abschwung fordern die Ökonomen, eine Abkehr von der schwarzen Null im Haushalt. Stefan Kooths vom Kieler Institut für Weltwirtschaft hält dagegen fiskalische Impulse für wenig sinnvoll:
Capital: In den vergangenen Wochen klang immer wieder das Argument an, Deutschland befinde sich längst in einer Rezession. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage der deutschen Konjunktur ein?
STEFAN KOOTHS: Für die Industrie können wir davon ausgehen, dass sie bereits in einer Rezession ist. Das bedeutet, dass die Normalauslastung der Kapazitäten unterschritten ist und weiter sinkt. Im Vergleich zu einer sogenannten technischen Rezession von zwei aufeinanderfolgenden Quartalen mit schrumpfender Wirtschaftsleistung ist das die ökonomisch gehaltvollere Variante. Denn letztere blendet immer aus, von welchem Niveau der Kapazitätsauslastung die Wirtschaft kommt. Erst wenn das Normalniveau unterschritten ist und die Auslastung weiter sinkt, liegt eine echte Rezession vor. Das ist in der Industrie derzeit der Fall. Für die Gesamtwirtschaft sehen wir das noch nicht. Insbesondere deshalb nicht, weil die konsumnahen Dienstleistungsbereiche sich noch robust zeigen und die Bauwirtschaft weiter auf Hochtouren läuft.
Welche Indikatoren sind für die Betrachtung der Wirtschaft gerade entscheidend? Ich denke da zum Beispiel an den ifo Geschäftsklimaindex...
Das ist weiterhin einer der wichtigsten Konjunkturindikatoren, auf den wir auch schauen. Zusätzlich nehmen wir Indikatoren in den Blick, die etwas über die Unsicherheit aussagen. Denn die aktuelle Industrieschwäche hat viel mit der Investitionsschwäche in der Weltwirtschaft zu tun. Wenn nicht klar ist, welche Bedingungen für das Wirtschaften in der weiteren Zukunft gegeben sind, reagieren Investoren typischerweise abwartend. Und genau das ist es, was von den handelsprotektionistischen Störmanövern aus den Vereinigten Staaten oder vom Brexit herrührt. Gerade für die konjunkturelle Einschätzung berücksichtigen wir außerdem Indikatoren, die etwas über die Auslastungsgrade aussagen. Neben Umfragen zur Einschätzung der Auslastung gehören dazu Umfragen zu den Faktoren, die die Produktion in der Wahrnehmung der Unternehmen am meisten behindern.
Welche Faktoren sind das?
Verfügbarkeit von Arbeitskräften ist einer davon. Die Werte hierzu stützen das Bild einer konjunkturellen Abkühlung, allerdings bewegt sich die Arbeitskräfteknappheit immer noch auf einem erhöhten Niveau. Auftragsmangel ist ein weiterer Indikator für das Konjunkturbild. Auch hier zeigt sich eine ähnliche Konstellation: Die Werte sind zwar gestiegen, liegen allerdings immer noch unterhalb des langjährigen Durchschnitts. Würde man also aufgrund der quartalsweisen Zuwächse von einer konjunkturellen Schwächephase sprechen, dann ist das, was wir seit Anfang 2018 gesehen haben, in erster Linie eine Abkühlung der Überhitzung zurück auf ein Normalniveau und noch nicht mehr – jedenfalls nicht gesamtwirtschaftlich.
Was bedeutet das für die nächste Zeit?
Eine wichtige Rolle spielt, wie stark die Industrieschwäche auf die konsumnahen Wirtschaftsbereiche ausstrahlen wird. In diesem Zusammenhang spielt auch eine Rolle, dass es von Seiten der Finanzpolitik spürbare Impulse gibt, die unmittelbar die Kaufkraft privater Haushalte stützen. Die Industrieproduktion wird man weitestgehend durchschwingen lassen müssen, hier kann die Politik wenig tun. Das typische Muster wäre, dass es etwa vier bis sechs Quartale braucht, bis nach dem Unterschreiten der normalen Auslastung allmählich wieder die Erholungsphase einsetzt. Das heißt: Es wären noch einige schwache Quartale für die Industrie zu erwarten, wenn sonst nichts anderes eintritt. Dass diese Entwicklung deutlicher auf die konsumnahen Bereiche durchschlägt, dürfte schwach ausgeprägt sein. Das liegt neben den schon erwähnten fiskalischen Effekten auch an den Unternehmen, die aufgrund der Fachkräfteknappheit möglichst lange an ihren Beschäftigten festhalten werden. Ein Teil der automatischen Stabilisatoren findet also bereits in den Unternehmen statt.
Wie sollte die deutsche Politik denn auf die aktuelle Wirtschaftslage reagieren?
Sie sollte nicht auf diese Schwächephase reagieren, denn gegen die Probleme, die es im Export gibt, kann die Wirtschaftspolitik praktisch nichts machen. Eine ganz andere Frage ist, ob die Wirtschaftspolitik wieder auf standortstärkende Maßnahmen einlenken sollte. Wir haben praktisch seit der Reformpolitik der Schröder-Regierung keine solchen Maßnahmen mehr gesehen. Von daher wäre man gut beraten, darüber nachzudenken, wie man ökonomische Aktivität und Investitionstätigkeit unabhängig von der konjunkturellen Schwäche in Deutschland wieder anreizt. Dazu kann zum Beispiel eine Unternehmenssteuerreform, also eine Unternehmenssteuersenkung, beitragen.
Wenn man von der nationalen auf die europäische Ebene geht – welche Rolle sollte die EZB spielen?
Der Euroraum zeigt sich zwar mit wenig Schwung, aber bleibt doch ziemlich robust. Auch dort sehen wir eine Normalauslastung der Produktionskapazitäten. Dort gibt es also überhaupt keinen Grund für stimulierende Maßnahmen. Im Gegenteil sollte sich die Geldpolitik damit beschäftigen, aus der Niedrigzinspolitik herauszukommen. Denn gerade stellt sich die Frage: Wie soll man dort überhaupt noch agieren, wenn eine konjunkturelle Krise tatsächlich käme? Man hat dort das Pulver schon verschossen. Die Nebenwirkungen dieser Politik überwiegen aktuell deutlich die davon noch zu erwartenden konjunkturellen Impulse. Von daher sehe ich überhaupt keinen Anlass, geldpolitisch auf die Tube zu drücken, sondern man sollte sich ganz im Gegenteil überlegen, wie man in die Normalisierung einsteigt. Das wäre jetzt viel wichtiger.
Welche Faktoren spielen denn für die künftige Entwicklung der deutschen Wirtschaft eine Rolle?
Es sind sicherlich weiterhin die politischen Turbulenzen, die uns zu schaffen machen, insbesondere die von den USA ausgehenden Handelskonflikte, die aber ein Aufwärts- wie ein Abwärtsrisiko darstellen.
Inwiefern?
Es spricht einiges dafür, dass man in den Vereinigten Staaten im Wahljahr 2020 eher den Ball flach halten will. Das würde ein Abfallen wirtschaftspolitischer Unsicherheit bedeuten. Ähnliches gilt für den Brexit. Der stellt für sich genommen eine Belastung dar, und auch hier hat die Unsicherheit schon längst Spuren hinterlassen. Schätzungen gehen dahin, dass das Niveau der Wirtschaftsleistung im Vereinigten Königreich durch den Brexit um die drei Prozent niedriger ist, als sie es ohne die Brexit-Turbulenzen wäre. Aber wenn erkennbar wird, wie künftige Wirtschaftsbeziehungen aussehen, kann das Unsicherheit herausnehmen. Doch auch die deutsche Politik sollte man nicht ausblenden. Noch ist unklar, ob die Koalition aus CDU und SPD überhaupt bis zum Ende der Legislaturperiode weiterregieren kann. Das ist ein weiterer Faktor, der uns im kommenden Jahr noch begegnen kann.
Stefan Kooths leitet seit 2014 das Prognosezentrum des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW). Zu seinen Arbeitsschwerpunkten zählen neben der Konjunkturforschung vor allem Fragen des Geld- und Währungswesens, der internationalen Wirtschaftsbeziehungen sowie der Ordnungsökonomik. Seit 2013 lehrt er Volkswirtschaftslehre an der University of Applied Sciences Europe am Campus Berlin. Er ist Mitglied der Friedrich August v. Hayek-Gesellschaft und des Mises Institutes. Er sitzt im Kuratorium des Prometheus-Instituts und gehört dem Präsidium des Internationalen Wirtschaftssenats (IWS) an.