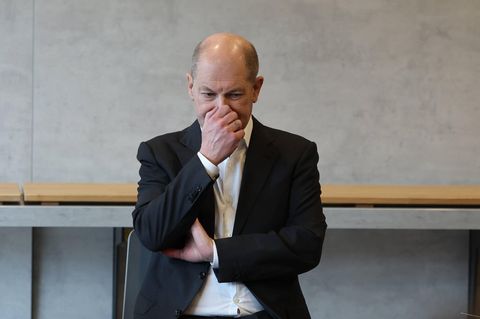CAPITAL: Herr Fuest, vor vier Jahren haben Sie sich hier in München auf Wohnungssuche gemacht - für eine fünfköpfige Familie. Was ging Ihnen damals durch den Kopf?
CLEMENS FUEST: (lacht) Oh ja, das war wirklich eine schmerzliche Erfahrung. In den zentrumsnahen Vierteln von München ist es heute für eine Familie kaum möglich, etwas Bezahlbares zu finden.
Und das sagt der Präsident des Ifo-Instituts mit einem sicher sehr ordentlichen Einkommen.
Richtig, ich bin nicht repräsentativ. Aber auch wir mussten lange suchen und merkten irgendwann, dass es immer teurer wird. Deshalb haben wir uns auf die Vororte verlegt. Da haben wir schließlich etwas Schönes gefunden, und ich bin sowieso lieber im Grünen. Aber es war selbst für uns nicht einfach.
Einer Ihrer Söhne studiert hier in München.
Ja, aber er wohnt noch zu Hause.
Warum, war ihm ein Auszug zu teuer?
Nein, mir war das zu teuer (lacht).
Was sollen da erst normale Angestellte denken, für die selbst Münchner Vororte unbezahlbar sind?
Der Wohnungsmarkt in deutschen Großstädten ist heute geteilt: Für diejenigen, die schon in der Stadt wohnen, sind die Veränderungen begrenzt. Eigentümer haben ohnehin kein Problem, Mieter sind von steigenden Bestandsmieten betroffen. Die steigen aber nur langsam, der Anstieg ist gesetzlich reguliert. Explodiert sind die Preise für alle, die Wohnungen wechseln oder neu in die Städte ziehen und Wohnraum suchen – auf diesem Markt haben sich Preise und Einkommen entkoppelt.
Was läuft schief in unserer Wirtschaft, wenn Leute mit normalen Einkommen in der Stadt, in der sie leben und arbeiten, keine ordentliche Wohnung mehr finden?
Das Problem ist nicht flächendeckend, es besteht vor allem in den angesagten Großstädten. Allerdings kann kein Wirtschaftssystem der Welt ein Problem der Knappheit auf dem Wohnungsmarkt von heute auf morgen ausgleichen.
Aber der Zuzug in die Städte kam ja nicht über Nacht, sondern hält seit bald zehn Jahren an.
Richtig, die Knappheit wäre geringer, wenn man mehr für das Wohnraumangebot getan hätte. Die Veränderungen sind massiv: Die Zahl der Singlehaushalte ist gegenüber den 90er Jahren deutschlandweit um 17 Prozent gestiegen, im Schnitt lebt eine Person heute auf 46 Quadratmetern, fünf Quadratmeter mehr als 2005. Allein hier in München leben heute 16 Prozent mehr Menschen als 2005. Wenn die Nachfrage nach Wohnraum so stark steigt und das Wohnungsangebot nicht mithält, sind hohe Preissteigerungen die Folge.
Viele sprechen von einem Marktversagen.
Der Markt funktioniert hier schon in dem Sinne, dass steigende Preise die Wohnungsknappheit signalisieren.
Dann müsste auf eine höhere Nachfrage und steigende Preise auch das Angebot steigen. Aber das tut es nicht.
Doch, allerdings nur sehr langsam. Das ist aber kein Marktversagen, eher Politikversagen, vor allem mangelnde Baulandausweisung.
Haben Sie Verständnis für Politiker, die zu immer radikaleren Instrumenten greifen wollen, um den Preisanstieg zu bremsen - bis hin zur Verstaatlichung ganzer Wohnungskonzerne oder einem Verbot von Mieterhöhungen?
Für die Debatte habe ich schon Verständnis. Wohnen ist ein fundamentales Bedürfnis des Menschen, anders als ein Kinobesuch oder eine Pauschalreise. Deswegen ist es richtig, dass wir diskutieren, was die Politik tun kann, um Menschen zu helfen, für die Wohnkosten unbezahlbar werden.
Dann bitte: Ist es richtig, per Gesetz – Bremse oder Deckel – den Anstieg der Mieten zu stoppen?
In Ausnahmesituationen kann es sinnvoll sein, Mieterhöhungen zu begrenzen, weil das Wohnungsangebot nur verzögert auf Mieterhöhungen reagiert. In Deutschland erreicht man dadurch aber wenig, das eigentliche Problem wird nicht gelöst.
Was ist das eigentliche Problem?
Wir bräuchten deutlich mehr Wohnungen für Menschen, die wenig verdienen. Geringverdiener leben häufig in Großstädten, sie haben selten Eigentum, sie leben oft allein und ziehen besonders häufig um. Deswegen sind sie stärker als andere von steigenden Mieten betroffen. Hilft diesen Menschen ein Verbot von Mieterhöhungen? Im Gegenteil: für diese Leute wird es dadurch noch schwerer, eine Wohnung zu finden.
Warum?
Wenn der Staat den Preis reguliert, wird der Ausgleich zwischen Angebot und Nachfrage eben nicht mehr über den Preis, sondern anders funktionieren. Zum Beispiel über Korruption: Wer das Geld hat, wird „hinten rum“ versuchen, an die Wohnung zu kommen – indem er dem Makler oder dem Vermieter Geld zukommen lässt. Vermieter werden noch mehr Wert als bisher darauf legen, dass Mietinteressanten ein sicheres Einkommen haben. Es werden außerdem Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt. Letztlich werden nur die geschützt, die schon eine Wohnung haben. Alle anderen müssen mehr kämpfen.
Aber wie dann rauskommen aus dem Dilemma?
Man sollte das Wohngeld in Großstädten erhöhen und mehr Bauland ausweisen. Wenn man eine soziale Mischung in den Innenstädten erhalten will, muss man den sozialen Wohnungsbau gezielt steigern. Dabei sollte man aber alte Fehler vermeiden, vor allem eine massenhafte Fehlbelegung. Regelmäßige Einkommenskontrollen für Mieter von Sozialwohnungen sind wichtig. Bessere Verkehrsanbindung des Umlands hilft ebenfalls.
Hinter diesem ganzen aufgeregten Streit über bezahlbare Wohnungen steht ja noch eine andere Diskussion: Es geht um Ungleichheit – während die Vermögenden in den letzten zehn Jahren massiv dazugewonnen haben, haben die, die wenig oder nichts haben, auch nichts dazugewonnen. Hat der Kapitalismus ein grundsätzliches Problem?
Wir sollten nicht vergessen, dass die wirtschaftliche Ungleichheit und die Armut weltweit seit Jahrzehnten sinken. Das ist ein Erfolg des Kapitalismus. Aber in vielen Industrieländern, auch in Deutschland, nimmt die Ungleichheit zu. Bei den Immobilienpreisen kommt ein spezifisch deutsches Problem hinzu: Bei uns haben relativ wenige Menschen Immobilieneigentum – knapp 60 Prozent sind Mieter. Daher profitieren hier auch weniger Menschen von Wertzuwächsen am Immobilienmarkt. Die statistisch gemessene Vermögensungleichheit nimmt dadurch zu.
Aber nicht die tatsächliche?
Doch, aber das Problem wird oft überzeichnet. Gesetzliche Rentenansprüche und Pensionen kommen in den Statistiken meistens nicht vor. Doch auch sie haben rasant an Wert gewonnen.
So stark sind die Renten nun auch wieder nicht gestiegen.
Aber ihr Wert. Rechnen Sie mal aus, wie viel Kapital Sie heute bräuchten, um bei den aktuellen Zinsen eine monatliche Rente von sagen wir 2000 Euro für zwanzig Jahre zu bekommen. Bei einer Verzinsung von 5 Prozent brauchten Sie vor 20 Jahren 300.000 Euro, heute sind es knapp 400.000 Euro. Diese Wertsteigerung wird in der Statistik nicht abgebildet.
Trotzdem habe ich ja weiterhin nur 2000 Euro Rente zum Leben.
Das gilt genauso für viele Immobilienbesitzer. Nehmen wir einen Freiberufler, der für seine Altersvorsorge außerhalb der Ballungszentren ein Haus vermietet. Er hat kaum Mietsteigerungen, aber der Marktwert des Hauses ist durch den Zinsrückgang stark gestiegen. An seinem monatlichen Einkommen hat das nichts geändert. Ähnliches gilt für den Selbstnutzer. Das Haus, in dem er wohnt, mag heute doppelt so viel wert sein wie vor 15 Jahren. Aber solange er es nicht verkauft, hat er nichts davon – da freuen sich allenfalls die Erben irgendwann.
Dennoch sind die Zahlen ja gewaltig: 3000 Mrd. Euro Wertzuwachs allein für die Immobilienbesitzer seit dem Jahr 2010, hat der Bonner Ökonom Moritz Schularick ausgerechnet.
Wer im eigenen Haus lebt, hat von diesen Wertsteigerungen wenig. Nur wenn man das Haus verkauft und aufs Land zieht kann man diese Gewinne realisieren. Aber wer macht das? Wenn man ausrechnen würde, um wie viel der Wert der Renten und Pensionen in den letzten Jahren gestiegen ist, käme auch eine astronomische Wert heraus. All das bedeutet wenig. Wichtiger sind die Mietsteigerungen in den Ballungsräumen. Sie kommen den Immobilieneigentümern zu Gute und stellen vor allem Haushalte mit niedrigen Einkommen vor große Probleme. Richtig ist außerdem, dass Inhaber von Immobilien und Aktien bei fallenden Zinsen deutlich besser dastehen als andere, die ihr Geld auf Sparbuch legen. Aber das ist ja seit langem bekannt.
Aber auch hier flammt die Diskussion auf: Nimmt der Staat das hin – oder muss er eingreifen?
Wenn die Zinsen mal wieder steigen wird niemand verlangen, dass der Staat die Immobilienbesitzer für Verluste entschädigt, warum also sollte man jetzt die Gewinne abschöpfen? Reformbedarf sehe ich allerdings im Steuersystem, bei der Besteuerung von Gewinnen durch Wertsteigerung. Bei selbstgenutzten Wohnungen wird der Wertzuwachs nicht besteuert. Verkauft man eine vermietete Wohnung, ist der Erlös zumindest nach zehn Jahren steuerfrei.
Sie meinen, der Staat sollte künftig die Gewinne aus Immobilienverkäufen genauso besteuern wie andere Einkünfte?
Ja, das würde ich zumindest für vermiete Immobilien für sinnvoll halten. Man müsste die Inflation berücksichtigen, aber das ist lösbar.
Aber unser Problem ist doch nicht, dass der Staat zu wenig Geld einnimmt, sondern dass zu wenige Menschen die Möglichkeit haben, eigenes Vermögen und Eigentum aufzubauen.
Es geht nicht um eine Bestrafung von Vermögenden, sondern um eine einheitliche Besteuerung aller Einkommen. Genau das fordert unsere Verfassung, das empfinden auch alle als fair. Man könnte auch selbst genutzten Wohnraum besteuern und eine fiktive Miete zu Grunde legen, aber das ist komplizierter.
Für alle, die jetzt hier in München für ihr Reihenhäuschen einen Kredit von einer Million Euro aufgenommen haben und sich abstrampeln, um die Raten zu bedienen, wäre so eine Steuer doch ein Schlag in die Magengrube.
Das ist richtig, deshalb wären lange Übergangsfristen notwendig, außerdem wäre der bürokratische Aufwand hoch. Deshalb sollte man bei den Wertzuwächsen vermieteter Wohnungen anfangen. Aber lassen Sie mich noch einmal auf das Thema der Vermögensungleichheit zurückkommen.
Nur zu!
Unser Finanzsystem macht es Menschen mit niedrigen Einkommen sehr schwer, Eigentum aufzubauen. In anderen Ländern, etwa in den USA, ist es für diese Gruppe leichter, einen Hypothekenkredit zu erhalten.
Wobei man fairerweise sagen muss, dass die USA mit ihren Subprime-Krediten ziemlich gemischte Erfahrungen gemacht haben.
Aber die eigene Immobilie ist der erste und klassische Weg, Vermögen aufzubauen. Um etwas gegen Vermögensungleichheit zu tun sollte man diesen Menschen bessere Chancen geben, Eigentum aufzubauen.
Was schwebt Ihnen vor?
Man sollte die Bankenregulierung so anpassen, dass Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen leichter Hypothekenkredite bekommen. Außerdem haben wir beim Ifo-Institut das Konzept eines Bürgerfonds vorgeschlagen.
Deutschland gründet jetzt auch einen Staatsfonds?
Eine Variante, ja. Der Bund könnte nach unserem Modell jedes Jahr Kredite im Umfang von einem halben oder einem ganzen Prozent des BIPs aufnehmen und dieses Geld in einen günstigen globalen ETF anlegen.
Neue Schulden für einen Staatsfonds?
Mit der Schuldenbremse wären diese Schulden vereinbar, weil wir damit Vermögen aufbauen. Die Idee ist: Wir nutzen die negativen Zinsen auf Bundesanleihen, und führen damit ein neues Instrument zur privaten Altersvorsorge ein.
Aber es gibt doch schon unendlich viele Vorsorgeprodukte, zum Teil auch staatlich subventioniert wie die Riester-Rente.
Es geht darum, die guten Verschuldungskonditionen des Staates für die Bürger zu nutzen. Das meiste, was heute auf dem Markt ist – auch die Riester-Produkte – nützt wegen hoher Gebühren vor allem den Anbietern. In unserem Fonds würden jedes Jahr 15 Mrd. Euro oder mehr zu sehr günstigen Konditionen angelegt. Jeder Bürger zwischen 17 und 67 Jahren bekäme ein Konto, auf dem seine Anteile verbucht werden. Und mit 67 hat dort jeder ein kleines Vermögen.
Sie haben sicher ausgerechnet, was jeder Bürger ausgezahlt bekäme.
Bei jährlich 0,5 Prozent des BIP Anlagesumme und einer Zinsdifferenz von 2 Prozent zwischen Staatsschulden und Anlageportfolio bekäme nach einer Ansparphase jeder Bürger mit 67 Jahren in heutigen Preisen 16 000 Euro ausgezahlt. Bei 3 Prozent Zinsdifferenz wären es schon 30 000 Euro. Wir würden die niedrigen Zinsen, die Deutschland als Safe Haven meiner Ansicht nach noch lange haben wird, nutzen – die hohe Bonität Deutschlands ist quasi unser Ölschatz.
Kann es sein, dass all die Umverteilungsdebatten, die wir gerade führen, von gestern sind – ein Echo der goldenen zehn Jahre, die nun zu Ende gehen? Immerhin hat sich die Konjunktur in den letzten sechs Monaten ja dramatisch verschlechtert.
Die deutsche Industrie befindet sich derzeit in einer Rezession. Die Exportbranchen, der Maschinenbau, die Autobauer und ihre Zulieferer haben große Probleme, die Produktion sinkt, erste Unternehmen bauen Jobs an. Das wird derzeit ausgeglichen durch eine boomende Bauindustrie, starke Dienstleistungen und einen starken Konsum, so dass wir bei Beschäftigung und Löhnen den großen Einbruch nicht sehen.
Drohen uns jetzt zehn magere Jahre?
Das kann sein. Derzeit steigert der Staat seine Ausgaben, die Notenbanken lockern ihre Geldpolitik, der Euro ist weiter sehr schwach. All das hilft uns kurzfristig. Doch es bleibt der eine große Faktor, der unser Wachstum nach unten zieht: Wir werden immer älter, die Zahl der Fachkräfte wird zurückgehen. Das spricht für deutlich niedrigere Wachstumsraten in den nächsten Jahren.
Die Verteilungskonflikte werden sich dann eher noch zuspitzen.
Ja, es gibt weniger zu verteilen. Allerdings denke ich, dass Arbeitnehmer eher gute Jahre vor sich haben.
Wieso das, wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst?
Weil Arbeitskräfte immer knapper werden. Ich erwarte nicht, dass die Automatisierung uns alle überflüssig machen wird. Wenn aber Arbeitskraft immer knapper wird, haben Sie als Arbeitnehmer einfach bessere Karten, hohe Lohnzuwächse auszuhandeln.
Goldene Zeiten ohne Wachstum?
Der Fachkräftemangel wird höhere Löhne erzwingen. Das ist die gute Nachricht, auch für alle Vermögens- und Verteilungsdebatten.
Das Interview stammt aus der neuen Ausgabe von Capital, die seit dem 18. Juli am Kiosk ist. Hier geht es zum Abo-Shop, wo Sie die Print-Ausgabe bestellen können. Unsere Digital-Ausgabe gibt es bei iTunes und GooglePlay