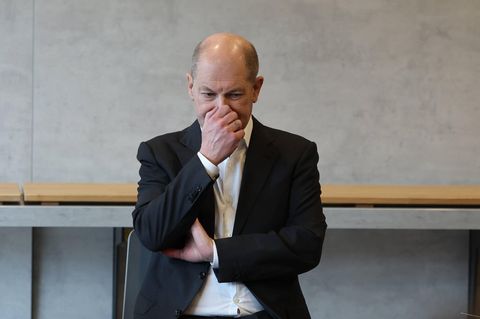Capital: Deutschland und Frankreich sind wegen des „Inflation Reduction Act“ (IRA) der Amerikaner besorgt. Sie fürchten massive Nachteile für die Industrien in Europa. Ist diese Sorge berechtigt oder reichlich übertrieben?
CLEMENS FUEST: Die Sorge um die europäische Industrie ist berechtigt. Aber die Ursache der Probleme ist nicht primär der IRA, sondern eine Reihe von Versäumnissen der Politik in Europa. Aber wenn der IRA dazu führt, dass man sich diesen Problemen zuwendet, ist es ja gut.
Welche Versäumnisse meinen Sie?
Man hat in Europa zu lange immer mehr Belastungen auf Unternehmen gehäuft: die weltweit höchsten Steuern, Regulierungen wie Nachhaltigkeitsberichtspflichten und verfehlte Datenschutzgesetze, um nur einige zu nennen. Bei der Vertiefung des Binnenmarktes geht dagegen wenig voran, noch immer ist es kompliziert, wenn Unternehmen in mehreren EU-Ländern agieren. Dabei ist der Binnenmarkt einer der wichtigsten Standortvorteile.
Auf dem Papier verteilt der IRA 369 Mrd. Dollar an Staatshilfen in erster Linie für Klimaschutz. Ist das viel oder wenig im Vergleich zu den EU-Hilfsfonds?
Allein der Krisenfonds „Next Generation EU“ sieht vor, dass mindestens 37 Prozent der verfügbaren 750 Mrd. Euro, also 277,5 Mrd. Euro in Preisen von 2018, in Klimaschutzinvestitionen fließen. Es kann aber auch deutlich mehr sein. Allerdings werden aus diesem Fonds teilweise Ausgaben finanziert, die die Mitgliedstaaten ohnehin getätigt hätten. Dennoch besteht auch in der EU kein Mangel an Mitteln für Subventionen.
Vieles im IRA klingt ja fast wie kopiert – E-Auto-Prämie, Förderprogramme für Klimaschutzmaßnahmen und Transformation auf saubere Energie – nur aber handwerklich besser gemacht...
Die IRA-Subventionen sind sicherlich sichtbarer und stärker auf die Industrie konzentriert. Die europäischen Subventionen fließen in sehr unterschiedliche Programme und sie sind deutlich weniger transparent.
Der IRA gewährt 40 Mrd. Dollar Steuerrabatte für Industrieunternehmen, die ihre Produktion auf nachhaltige Energie umstellen. Die EU will nun auch Steuerrabatte und eine Lockerung des Beihilferechts. Ist das sinnvoll?
Grundsätzlich ist die Beihilfenkontrolle eine wichtige Errungenschaft der EU. Sie verhindert Wettbewerbsverzerrungen im europäischen Binnenmarkt. Bevor man hier Änderungen beschließt, sollte man Einigkeit darüber erzielen, welche Subventionsinstrumente zugelassen werden sollen und welche nicht.
Bremst das EU-Beihilferecht sinnvolle Subventionen auf Länderebene aus?
Das EU-Beihilferecht ist nicht dafür konzipiert, Rahmenbedingungen für eine Transformation hin zur Klimaneutralität zu schaffen. Welche Spielräume benötigt werden, hängt unter anderem davon ab, wie andere klimapolitische Instrumente eingesetzt werden, beispielsweise CO2-Preise.
Besteht die Gefahr, dass ein gelockertes Beihilferecht vor allem den reichen Ländern wie Frankreich und Deutschland hilft?
Dieses Argument wird überstrapaziert. Da Deutschland einen größeren Industriesektor als viele andere EU-Staaten hat, braucht es für die Transformation dieses Sektors auch mehr Geld. Durch den EU-Haushalt und den Krisenfonds „Next Generation EU“ wird bereits viel Geld zu Gunsten der ärmeren Länder in der EU umverteilt.
Die Rede ist aber auch von neuen Subventionen. Verkraftet die EU überhaupt noch weitere Staatshilfen? Die Töpfe sind doch relativ voll und das Geld fließt nur langsam ab.
So ist es. Wir brauchen nicht zusätzliche Subventionstöpfe, sondern eine effektivere Verwendung der vorhandenen Mittel. Hinzu kommt, dass die Forderung nach neuen kreditfinanzierten Subventionstöpfen kommt, bevor überhaupt geklärt ist, wofür das Geld genau gebraucht wird. Wir müssen außerdem bedenken, dass wir in Zeiten hoher Inflation leben. Mehr schuldenfinanzierte Töpfe würden die Inflation weiter erhöhen und die Notenbanken zwingen, Zinsen noch stärker zu erhöhen. Das würde andere Investitionen verdrängen.
Woran liegt dieser teils langsame Abfluss eigentlich? Ist die Förderung nicht gut gemanagt?
Da gibt es viele Gründe, es fehlen überzeugende Projekte, die Entscheidungsprozesse sind übermäßig bürokratisch, es gibt enormen Abstimmungsbedarf zwischen der europäischen und der nationalen Ebene und die Planungs- und Genehmigungsverfahren sind langwierig.
Es gibt zunehmend Firmen, zum Beispiel Intel, die quasi Subventionen erzwingen wollen und sonst abwandern beziehungsweise sich gar nicht erst ansiedeln. Werden uns künftig strategisch wichtige Unternehmen erpressen und ein Bieterwettlauf zwischen USA, China und Europa starten?
In der Tat, vor allem bei großen und öffentlich sichtbaren Prestigeprojekte wie Chipfabriken besteht die Gefahr, dass ein doppelter Subventionswettlauf entsteht. Erstens zwischen den USA und Europa und zweitens unter den EU-Mitgliedstaaten.
Sollte Deutschland bei Intel deshalb hart bleiben? Machen wir uns sonst nicht erpressbar?
Die EU-Beihilfenkontrolle hilft Staaten dabei, in solchen Fällen hart zu bleiben, auch deshalb sollte man sie nicht in Frage stellen. In Einzelfällen kann es sinnvoll sein, Subventionen zu zahlen, aber man sollte verlangen, dass das dann gut begründet ist. Ob das im Fall Intel so ist, habe ich nicht geprüft.
Brauchen wir eine „Europe First“-Strategie inklusive Produktionszielen für bestimmte strategisch wichtige Sektoren, so dass wir selbst Chips, Batterien und wichtige chemische Güter herstellen können?
Eine „Europe First“-Strategie birgt die Gefahr, dass Subventionen und protektionistische Politiken Partikularinteressen dienen, die Wirtschaftsentwicklung insgesamt aber schädigen. Richtig ist, dass zunehmende geopolitische Risiken es erforderlich machen, Abhängigkeiten von Lieferungen wichtiger Produkte aus anderen Ländern genauer unter die Lupe zu nehmen. Gerade gegenüber den USA spielt diese Gefahr aber eine geringe Rolle. Wenn die USA mit massiven Subventionen den Aufbau von Batteriefabriken subventionieren wollen, spricht nichts dagegen, dass wir künftig mehr Batterien für Elektroautos importieren. Das ermöglicht uns, knappe Ressourcen wie etwa Fachkräfte für andere Dinge einzusetzen.