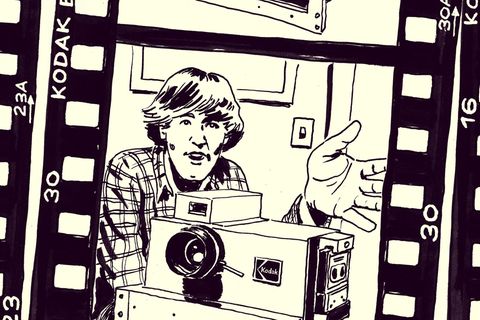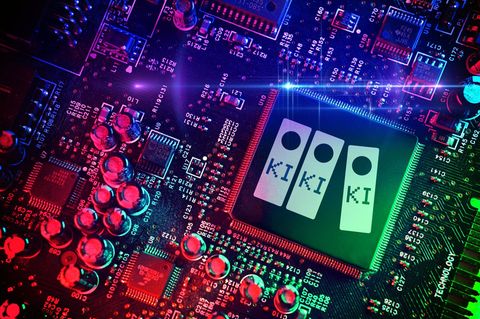Martin Kaelble ist Capital-Redakteur und schreibt an dieser Stelle über Digitalisierung, Startups und die neue Wirtschaft.
Ungleichheit und Digitalisierung, zwei Mega-Themen unserer Zeit. Die jedoch in der Regel komplett getrennt voneinander diskutiert werden. Bei den einen liegt Thomas Pikettys Bestseller "Capital in the 21st century" auf dem Schreibtisch, bei den anderen die Biografie von Elon Musk. Und je nachdem welches Buch dort herum liegt, fällt der Blick auf die Digitalisierung komplett unterschiedlich aus.
Künftig dürften beide Themen jedoch verschmelzen. Denn die Digitalisierung hat das Potenzial die Ungleichheit massiv zu verschärfen – als gigantischer Jobvernichter, als eine Art Turbo-Kapitalumverteilung nach oben. Das Potenzial wohlgemerkt. Ob es wirklich so kommt, ist eine andere Frage.
Digitale Zerstörung
Das Negativ-Szenario sieht ungefähr so aus: Ein Start-up beschäftigt im besten Fall ein paar hundert Mitarbeiter, zerrüttet zugleich aber eine Industrie mit ein paar tausenden Beschäftigten. Dort verlieren viele ihre Jobs, verdienen weniger oder rutschen in prekäre Beschäftigungen. Nehmen wir den Fahrdienst Uber. Aufgemischt wird unter anderem die Taxibranche, mit vielen Kleinbetrieben, einfachen Leuten, denen das organisierte Taxigewerbe gewisse Mindesteinkommen und Sicherheiten garantiert. Diese werden durch Uber angegriffen. Fahren sie künftig für Uber, verdienen sie mitunter weniger, sind nicht mehr gewerkschaftlich oder irgendwie anders organisiert. Das Ergebnis: Die Prekarisierung einer Branche. Oft genug bedeutet die unregulierte, digitale Variante eines Business also nicht die so super sozial klingende Sharing Economy. Sondern letztlich Super-Kapitalismus in Reinform.
Die Folgen von Monopolen oder einer extremen Automatisierung sind hier noch nicht einmal einberechnet. Fortschreitende Automatisierung könnte zur absoluten Effizienzsteigerung auf Kosten von Jobs werden. Quasi die Erfüllung aller ur-ökonomischer Bestrebungen. Das Digitale als zentrales Mittel mit wenigen Leuten etwas anzubieten, wofür es vorher viele gebraucht hat. Ein Traum für Unternehmer und Kapitalgeber. Ein Albtraum für Arbeitnehmer.
Silicon Wall Street
Soviel zu den Jobs. Vielleicht noch interessanter ist der Blick auf die Kapitalseite. Denn diese Seite der Rechnung ist den wenigsten bewusst und am wenigsten diskutiert. Alle feiern Start-ups und freuen sich über die neuen innovativen Firmengründungen. Doch eine Frage wird dabei selten gestellt: Wer verdient eigentlich, wie viel an einem Start-up? Dazu muss man erst einmal die Finanzierung der Disruption verstehen.
Die paar hundert jungen Mitarbeiter deren Jobs durch ein Start-up geschaffen wurden, arbeiten viel und lange für eine vergleichsweise geringe Bezahlung (sofern sie als Mitarbeiter der ersten Stunde nicht Anteile haben), verdienen weniger als in einem Konzern, dafür haben sie gratis Müsli in der Küche und sitzen in einem trendigen Fabrikloft. Deutlich mehr streichen natürlich die Gründer ein. Allerdings muss man wissen, dass auch sie bei einem Verkauf oder bei einem Börsengang nicht die Hauptkasse machen. Im Laufe der Finanzierungsrunden werden ihre Anteile immer kleiner. Es ist nicht ungewöhnlich, dass bei einem millionenschweren Exit der Gründer keineswegs selbst Millionär wird.
Der größere Teil wandert in die Reihen der Risikokapitalgeber, die das Start-up finanzieren. In den USA ist es ein überschaubares Bündel von Top-Venture-Capital-Firmen, die mit den wirklich erfolgreichen Start-ups Cash gemacht haben und mittlerweile an die besten Deals kommen. Namen wie Sequoia, AndreesenHorowitz, Benchmark, Accel oder KleinerPerkins. Dort häufen sich die gigantischen Gewinne der Digitalisierung. Diese VCs wiederum finanzieren Start-ups, indem sie selbst Fonds aufsetzen. Wer in diese Fonds investiert, streicht – am Ende der Kette - eine satte Rendite ein. So funktioniert das System Start-up.
Der kleinste Teil des Kuchens kommt in Form von Gehältern bei den Mitarbeitern an. Der größte Teil maximiert die Investments der Investoren. Ganz klassischer Finanzkapitalismus, investiertes Kapital wird weiter maximiert. Und damit wären wir bei Piketty.
Die schillernde Start-up-Welt hat dann plötzlich doch wieder viel mit den gängigen Mustern des Finanzkapitalismus zu tun, die seit Lehman so verpönt sind. Und das Start-up-Ökosystem erscheint plötzlich unterm Strich wie ein Instrument in Reinform für das, was Piketty beschreibt: die ein Prozent vermehren ihr Vermögen immer weiter durch schlaue Investments, in diesem Fall in die Start-up-Job-und-Einkommens-Vernichtungsmaschinen.
Das Positiv-Szenario
Soweit das Negativ-Szenario. Doch ganz so einfach ist die Rechnung nicht.
Schon auf der Finanzierungsseite lässt sich die Geschichte genauso gut anders erzählen. Unter den Geldgebern für Venture Capital Fonds sind ganz am Ende der Kette zwar auch Family Offices, wohlhabende Individuen, Banken und Versicherungen. Speziell in den USA sind aber die wichtigsten Geldgeber institutionelle Anleger aus der Mitte der Gesellschaft - wie Stiftungen und Pensionskassen. Die Gewinne aus den Start-ups werden über diesen Umweg also doch wieder über die gesamte Gesellschaft gestreut. Hinzu kommt: Im neuen Tech-Ökosystem bekommen Menschen durch Startup-Pitches Zugang zu Risikokapital, die in der alten, elitären Welt vielleicht nie einen Termin bei einem Investor bekommen hätten.
Und so haut das bei genauerer Betrachtung mit Piketty schon nicht mehr so ganz hin.
Auf der Jobseite ist es noch komplizierter. Die Frage, ob Start-ups weniger Jobs aufbauen als sie zerstören, wird in den USA seit längerem und in Deutschland neuerdings diskutiert. Der amerikanische Ökonom Tyler Cowen hat mit seinem Buch „The Great Stagnation“ großen Anteil an der Debatte. Ein anderer US-Ökonom, Robert Gordon, warnte jüngst in seinem neuen Buch vor einem Stillstand der Innovation. Die Digitalisierung sei im Vergleich zur Erfindung der Elektrizität nur ein marginaler Sprung. Die Quintessenz dieser Debatte: Tech-Firmen schaffen deutlich weniger Jobs als es die Fabriken in der Frühphase der Industrialisierung getan haben. Und bislang ist das Internet mit seiner Gratiskultur in vielen Bereichen eine Katastrophe fürs Bruttoinlandsprodukt und die Wertschöpfung.
Indirekte Beschäftigungseffekte
Diese Debatte ist wichtig und kommt in Deutschland immer noch zu kurz. Allerdings muss man Gordon, Cowen & Co. auch entgegenhalten: Wir sind eben noch in der Frühphase der Digitalisierung. Es ist sehr schwer abzuschätzen, wie viele tausende Jobs es eines Tages in einem Dax-notierten Handelskonzern Zalando geben wird. Und was passiert, wenn immer mehr Dienste Geld kosten, weil sie aus der frühen, Venture Capital gestützten Phase des Erstmal-Reichweite-aufbauen-und-dann-schauen-wie-man-damit-Geld-verdient raus sind.
Hinzu kommt: Häufig werden die Jobs übersehen, die indirekt durch Start-ups in einer dezentralen Digital-Wirtschaft entstehen. Im Fahrwasser Googles entstanden unzählige Dienstleister wie zum Beispiel SEO-Agenturen. Ein Uber zerrüttet zwar die Taxibranche. Zugleich schaffen Plattformen aus der Gig Economy oder Sharing Economy wie Uber oder Instacard aber völlig neue Zugänge zu Jobmärkten, für Rentner zum Beispiel, die vorher gar nicht gearbeitet haben. Die Ressource Arbeit kann mitunter effizienter verteilt werden. Ärmere Leute haben plötzlich viel mehr Möglichkeiten Geld zu verdienen, durch eine Sharing-Nutzung ihres Autos, einen Uber-Gig oder die Vermietung einer Wohnung bei Airbnb. Wo früher enorme Hürden für den Vertriebsweg die Existenz kleiner Selbstproduzenten verhinderten, können sich Menschen nun über Marktplätze wie Ebay oder Etsy selbstständig machen oder Geld neben einem Job hinzuverdienen.
Insgesamt dürften die Beschäftigungseffekte der Digitalisierung viel indirekter sein als in der alten geordneten Welt. Nur zu vergleichen, wie viele Mitarbeiter ein Tech-Konzern im Vergleich zu einem Old Economy Konzern beschäftigt, greift in der dezentralen Digitalwirtschaft zu kurz. Vielmehr sind die Start-ups nur die Plattformen mit ein paar hundert Mitarbeitern, die aber wiederum vielen tausenden kleineren Einheiten Beschäftigung überhaupt erst ermöglichen – was dann erst die Gesamtsumme der entstandenen Jobs ergibt – und wohlgemerkt deutlich schwerer zu messen ist. Eine Bilanz über Jobvernichtung vs. Jobschaffung durch das Internet ist demnach extrem schwer zu ziehen zum jetzigen Zeitpunkt.
Ausgang offen
Auch die Frage nach den Zugängen zur Beschäftigung ist wichtig. Der nächste CEO eines Mittelständlers war in der Vergangenheit vermutlich ein Sprössling der Familie (sofern es mit der Nachfolge geklappt hat). Der nächste CEO eines Großkonzerns oder einer Bank kam oft genug aus besseren Verhältnissen oder musste zumindest in Harvard oder St. Gallen gewesen sein. Natürlich kommen auch heute noch viele Gründer aus Stanford oder der WHU. Aber: Ein Start-up kann mit einer guten Idee im Prinzip jeder gründen, die Plattformen ermöglichen jedermann am Arbeitsmarkt zu partizipieren ohne Vorstellungsgespräche, wo die Herkunft abgecheckt wird. Unterm Strich ist die Digitalwirtschaft also deutlich offener als die strukturell starre und elitäre alte Wirtschaft. Start-ups, neuer Gründergeist, besagte Plattformen dürften also die soziale Mobilität erhöhen. Und damit wieder auf das Megathema Ungleichheit Einfluss haben.
Letztlich hängt also alles von der Perspektive ab, mit der man auf die Digitalisierung schaut. Und ganz gleich, durch welche Brille man dabei scheint - es scheint noch zu früh, um eindeutige Schlüsse ziehen zu können. Klar ist aber eines schon jetzt: Die Themen Ungleichheit und Digitalisierung werden künftig miteinander verschmelzen. Und dieses Thema wird uns die nächsten Jahre noch intensiv beschäftigen.
Newsletter: „Capital- Die Woche“
Jeden Freitag lassen wir in unserem Newsletter „Capital – Die Woche“ für Sie die letzten sieben Tage aus Capital-Sicht Revue passieren. Sie finden in unserem Newsletter ausgewählte Kolumnen, Geldanlagetipps und Artikel von unserer Webseite, die wir für Sie zusammenstellen. „Capital – Die Woche“ können Sie hier bestellen: