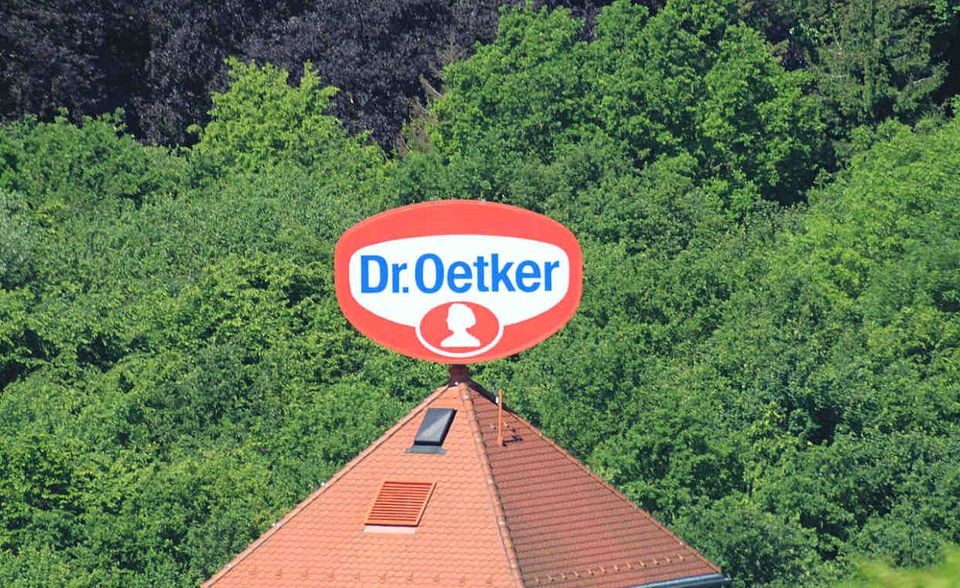Capital: Herr Prof. Binz, immer wieder kommt es in Familienunternehmen zu Streitigkeiten zwischen einzelnen Familienmitgliedern. Jüngstes Beispiel ist die Kaffeedynastie Darboven. Ist es immer eine Generationenfrage oder wo liegen die Hauptursachen?
Mark Binz: Die Frage, ob ein Nachfolger aus der Familie wirklich geeignet und ausreichend talentiert ist, kann zwischen Vater und Sohn, aber auch innerhalb mehrerer Familienstämme durchaus gegensätzlich eingeschätzt werden, birgt also erheblichen Zündstoff, zumal es dabei auch um die Höhe der Geschäftsführervergütung und unternehmerischen Einfluss geht. Ganz generell kann man sagen, dass sich die meisten Konflikte in einem Familienunternehmen, gleich welcher Größe, fast immer innerhalb des magischen Dreiecks von Macht, Liebe und Geld abspielen.
Warum fällt es manchen Firmenpatriarchen wie Albert Darboven oder Heinz-Hermann Thiele so schwer loszulassen?
Das sind tiefverwurzelte psychologische Gründe. Erfolgreiche Patriarchen haben meist mit viel Fleiß, Können und Hingabe ein Firmenimperium aufgebaut, ihr Lebenswerk eben. Nach so vielen Jahren als Alphatier den Staffelstab an eines der Kinder weiterzugeben, fällt nicht nur schwer, sondern ist auch eine große Verantwortung. Natürlich mag auch die Furcht mitschwingen, nicht mehr die erste Geige zu spielen oder gar, nicht mehr gebraucht zu werden. Wenn dann der Nachwuchs nicht über dieselbe persönliche Exzellenz verfügt oder sich gegenüber dem Vater respektlos oder aufgrund seiner internationalen Ausbildung an privaten Elite-Hochschulen auch noch besserwisserisch verhält, ist der Eklat programmiert.
In einigen Fällen streiten Geschwister um eine Firma. Bahlsen war so ein Beispiel. Bleibt dann nur die Aufteilung des Geschäfts unter den Familienmitgliedern?
Wenn ein Streit zu lange und zu fundamental eine Familie oder Gesellschafterstämme entzweit und Mediationen scheitern, ist eine Trennung oft der einzige Ausweg. Neben einer Realteilung, die freilich oft Synergien vernichtet, gibt es noch andere Möglichkeiten: gesellschaftsinterne Auktionen, bei denen der Meistbietende das Unternehmen oder die Mehrheit der Anteile übernimmt, ein Verkauf, ein IPO, die Aufnahme eines weiteren unternehmerischen Partners in den Gesellschafterkreis, insbesondere um Pattsituationen aufzulösen. Oder der Rückzug der zerstrittenen Senioren in einen Beirat oder Aufsichtsrat kann einen probaten Lösungsansatz darstellen.
Manchmal landet der Familienzwist auch vor Gericht. Ihre Kanzlei war mehrfach an solchen Prozessen beteiligt. Wie kann man verhindern, dass es so weit kommt?
Eine vorausschauende Familienverfassung, vorab festgelegte Regeln zur Konfliktlösung, externe Aufsichtsräte oder Beiräte, die zwischen den streitenden Parteien vermitteln, oder ein kompetent besetztes Schiedsgericht, das Zeit und Geld spart, vor allem aber vor der Öffentlichkeit schützt: Es gibt mehrere Instrumente, damit ein Konflikt nicht eskaliert. Ich rate Mandanten gerne, statt kontroverse Punkte immer unter den Teppich zu kehren, besser eine eigene Streitkultur aufzubauen, bei der man sich inhaltlich miteinander auseinandersetzt, ohne dass dabei persönliche Verletzungen entstehen. Es ist alles eine Frage des guten Willens, aber auch der Organisation!
Familienstreit: 15 prominente Beispiele deutscher Unternehmen
15 prominente Konflikte in großen Familienunternehmen
Die Brüder Adolf und Rudolf Dassler fochten einen epischen Kampf. In den 1920er Jahren gründeten sie im fränkischen Herzogenaurach eine Schuhfabrik, die schon bald für ihre innovativen Sportschuhe mit Spikes und Stollen Weltruf erlangte. In den Wirren des Zweiten Weltkriegs zerbrach die Einheit, die kurz nach dem Ende des Krieges zur Aufteilung in Adidas (Adolf Dassler) und Puma (Rudolf Dassler) führte. Der Fernsehfilm „Duell der Brüder – Die Geschichte von Adidas und Puma“ (2016) beschreibt sachkundig das unterschiedliche Brüderpaar und ihre frühen Konflikte, die in eine jahrzehntelange Spaltung Herzogenaurachs in zwei Lager mündete. Trotz des Bruderzwists entstanden zwei Weltmarken.
Die Familien Porsche und Piëch kontrollieren seit der gescheiterten Übernahme des Volkswagen-Konzerns durch Porsche nicht nur den Sportwagenbauer, sondern inzwischen Deutschlands größten Industriekonzern. Und dass, obwohl sich die beiden Clanchefs Ferdinand Piëch und Wolfgang Porsche, in Charakter und Haltung grundverschieden, über Jahrzehnte hinweg regelrecht bekriegt haben. Ferdinand Piëch hielt als Vorstands- und später Aufsichtsratsvorsitzender bei VW lange das Zepter in der Hand, bis er mit dem Versuch scheiterte, VW-Vorstandschef Martin Winterkorn zu feuern; anschließend verkaufte er schmollend seine Anteile. Heute sitzt Wolfgang Porsche dem Aufsichtsrat von VW vor und versucht, in der nachrückenden Generation der beiden Familienstämme die Harmonie wiederherzustellen.
Die acht Erben des verstorbenen Bielefelder Clan-Chefs Rudolf-August Oetker stammen aus drei verschiedenen Ehen. Die fünf älteren Geschwister um August und Richard Oetker hielten lange die Fäden im Konzern in Händen, bis die jüngere Generation, angeführt von Ferdinand Oetker, seit 2014 lautstark und öffentlich mehr Einfluss in der Geschäftsführung einforderte. Die sich anbietende Fusion der eigenen Schifffahrtslinie Hamburg Süd mit Hapag Lloyd scheiterte an ihrem Widerstand. 2016 bei der Besetzung des Beirats und dem Verkauf der Containerschifffahrt (2017) raufte man sich zu Kompromissen zusammen, eine langfristig tragfähige Lösung wie etwa eine Realteilung, über die schon lange spekuliert wird, scheint jedoch noch nicht gefunden.
Bernd und sein jüngerer Bruder Clemens Tönnies machten aus der elterlichen Metzgerei einen milliardenschweren Fleischkonzern. Nach dem Tod von Bernd 1994 übernahm Clemens Tönnies (M.) das Steuer und setzte die Expansion erfolgreich fort; seine beiden Neffen Robert (r.) und Clemens jun. wollte er jedoch nicht an der Führung beteiligen, obwohl diesen anfangs sogar die Mehrheit der Anteile zustanden. Robert wehrte sich gegen diese Entmachtung in einem durch alle Instanzen geführten Rechtsstreit - mit Erfolg. Am Ende einigte man sich auf die Errichtung einer gemeinsamen Familien-Holding, in die Clemens Tönnies, im Nebenberuf Präsident des Bundesligavereins Schalke 04, sein heimlich aufgebautes Wurstimperium einbrachte und an der nunmehr Clemens und Robert je zur Hälfte beteiligt sind. Seitdem herrscht in dem ostwestfälischen Vorzeigeunternehmen Familienfrieden.
In den 90er-Jahren gehörten die Bahlsens zu den streitlustigsten Familienunternehmern. Brüderkampf, Onkel gegen Neffen, die Fronten waren über viele Jahre vielfältig. In der Hannoveraner Keksfabrik flogen die Fetzen, bis es zu einer Teilung des Geschäfts kam. Herrmann Bahlsen, einer der Kombattanten, wurde abgefunden und das Backwarenunternehmen im Rahmen einer Realteilung in die Bereiche „süß“ und „salzig“ zerlegt, die dann jeweils eigenständig von den Brüdern Werner Michael und Lorenz Bahlsen geführt wurden. Die Familienfehde ist seither ausgestanden.
Seit 1968 führt Albert Darboven (Foto) die gleichnamige traditionsreiche Hamburger Kaffeefirma. Als er sich mit seinem Sohn Arthur, dem er schon eine Anteilsmehrheit geschenkt hatte, überwarf, verließ dieser 2009 im Streit das Unternehmen. Daraufhin widerrief der Vater die Schenkung und wurde damit wieder zum Mehrheitsgesellschafter. Der Konflikt flammte kürzlich wieder auf, weil der inzwischen 82-jährige Albert Darboven seine Nachfolge regeln wollte, indem er Andreas Jacobs, einen Spross der ehemaligen Bremer Kaffeedynastie Jacobs, adoptieren möchte. Gegen diesen Schachzug läuft Arthur Darboven Sturm, der als leiblicher Sohn und gesetzlicher Allein-Erbe seine Felle wegschwimmen sieht. Der Fall bleibt spannend.
Der Spirituosenhersteller Berentzen ist einer jener tragischen Fälle, in denen der Zoff zwischen Gesellschaftern das Ende als unabhängiges Familienunternehmen einläutete. Und das kam so: Das 250 Jahre alte Unternehmen kaufte 1988 zur Portfolioerweiterung die Kornbrennerei Pabst & Richarz. Im Gegenzug erhielten die Eigentümer von Pabst & Richarz Anteile an der fusionierten Firma. Das Zusammenspiel funktionierte jedoch nicht. Im Gegenteil, es entwickelte sich eine jahrelange Dauerfehde, die erst 2008 mit dem Verkauf an das Beteiligungsunternehmen Aurelius endete.
Heinz-Herrmann Thiele (Foto) hat über die Jahre mit Knorr-Bremse und der börsennotierten Vossloh AG ein beachtliches Industrieimperium geschaffen. Die familieninterne Nachfolge war indes weniger erfolgreich. Zwar hatte der Patriarch seinem Sohn Hendrik und seiner Tochter Julia bereits in den 90er-Jahren mehr als die Hälfte der Anteile übertragen, sich jedoch stets die Stimmenmehrheit vorbehalten. 2015 schied Sohn Hendrik kurz vor seiner Berufung in den Vorstand im Streit mit dem Vater aus der Geschäftsführung und im Sommer letzten Jahres auch als Gesellschafter aus. Der Konzern gehört jetzt dem 77-jährigen Thiele und seiner Tochter, die jedoch im Unternehmen nicht aktiv tätig ist. Im Oktober platzierte Thiele einen wesentlichen Teil seines Aktienbesitzes an der Knorr-Bremse AG im Oktober an der Börse. Das brachten ihm und seiner Tochter 3,9 Mrd. Euro ein.
Die fünf Hamburger Herz-Geschwister stritten über Jahrzehnte um das unternehmerische Erbe ihres Vaters und Tchibo Gründers Max Herz, der zu seinem Tode 1965 zwar ein bedeutendes Unternehmen des deutschen Wirtschaftswunders hinterließ, aber keine klare Nachfolgeregelung. Zunächst leitete der älteste Sohn Günter Herz das Imperium. Von seinen jüngeren Brüdern stets misstrauisch beäugt, stürzte Michael Herz zusammen mit Mutter Ingeborg und Joachim und Wolfgang Herz den Ältesten im Jahr 2001 vom Firmenthron. Michael übernahm den Chefposten. Günter und seine Schwester Daniela verkauften 2003 ihre Firmenanteile für über 4 Mrd. Euro und sind seither über ihre Beteiligungsfirma Mayfair unternehmerisch aktiv.
Im Verlag DuMont Schauberg kam es Ende 2010 zu einem kurzen, aber heftigen Showdown. Der Verlegersohn Konstantin Neven DuMont wurde kurzerhand von seinem Vater Alfred Neven DuMont (Foto) aus dem Vorstand des Unternehmens entfernt, nachdem er sich in einem Weblog abträglich über das eigene Verlagshaus geäußert hatte. Später übertrug Konstantin Neven DuMont, der ursprünglich das verlegerische Erbe seines Vaters hätte antreten sollen, nach einer öffentlich ausgetragenen Schlammschlacht auch seinen siebenprozentigen Anteil an die Familie zurück. Seine Schwester Isabella Neven DuMont ist inzwischen in die Fußstapfen ihres verstorbenen Vaters getreten, wodurch der Familienfriede wiederhergestellt worden ist.
Haribo ist ursprünglich das Werk zweier Männer, die den Süßwarenkonzern rund um die Gummibärchen gemeinsam aufgebaut haben: Hans und Paul Riegel. Während Hans als Marketinggenie galt, kümmerte sich der besonnene Paul um Technik und Produktion. Da Hans kinderlos blieb, hing die Nachfolgfrage jahrzehntelang in der Luft. Mehrere Anläufe und eine Mediation scheiterten. Als der ältere Bruder Paul 2009 verstarb und der inzwischen über 80-jährige Hans eine österreichische gemeinnützige Stiftung als Nachfolger präsentieren wollte, kam es zum Streit - aber anschließend zu einer salomonischen Lösung: mit dem Tod von Hans erbte die Stiftung seinen 50-Prozent-Anteil, die unternehmerische Führung blieb aber in der Hand der Familie. Seither leitet Pauls Sohn Hans-Arndt den neu geschaffenen Holding-Aufsichtsrat, sein Bruder Hans Guido ist alleiniger Geschäftsführer der Unternehmensgruppe.
Schon das Brüderpaar Theo und Karl Albrecht, die lange Zeit zu den reichsten Deutschen zählten, war sich in der Frage, ob Zigaretten ins Sortiment gehören, uneins und teilte ihr entstehendes Discounter-Reich in Aldi Süd und Aldi Nord, blieben sich jedoch Zeit ihres Lebens menschlich eng verbunden. Sie waren so verschwiegen, dass es nicht einmal aktuelle Fotos von ihnen gab. Turbulent geht es dagegen unter den drei Erben-Stämmen zu. Während sich Theo Albrecht jr. als Bewahrer des Familienerbes und einer diskreten Firmenkultur sieht, scheut seine Schwägerin Babette (Foto) nicht das Licht der Öffentlichkeit, wie der gewonnene Millionen-Prozess gegen den betrügerischen Kunsthändler Achenbach zeigt. Auch kämpft sie um mehr Einfluss ihrer Familie auf die von ihrem verstorbenen Schwiegervater errichtete Familienstiftung und damit letztlich um die Macht im Unternehmen.
Ähnlich wie bei Oetker stehen sich die Nachfahren aus unterschiedlichen Ehen des Unternehmers und Bankiers August von Finck unversöhnlich gegenüber. Auf der einen Seite August und der inzwischen verstorbene Wilhelm von Finck, Sprosse aus erster Ehe. Auf der anderen Seite Helmut („Billy“) Baron von Finck, Sohn aus zweiter Ehe. Billy wurde von seinen Halbbrüdern fünf Jahre nach dem 1980 verstorbenen Vater mit 65 Millionen Mark auffällig bescheiden abgefunden. Das wollte er nicht auf sich sitzen lassen und streitet seit 2009 vehement gegen die Gültigkeit des Erbverzichtsvertrages, auch damit sein Sohn Nino ein größeres Stück des milliardenschweren Kuchens abbekommt.
Die Nachfolge um das unternehmerische Erbe des Reinemachkönigs Peter Dussmann ist die Geschichte vom Zank zwischen Tochter und Mutter. Tochter Angela heiratete zum Missfallen des Vaters den Esoteriker Ronald Göthert. Das führte zu ihrer Enterbung. Gattin und Witwe Catherine von Fürstenberg-Dussmann (l.) avancierte zur Stiftungsratschefin. Angela Dussmann (r.) will die Reduktion auf den gesetzlichen Pflichtteil von 25 (statt 50) Prozent nicht hinnehmen, bezweifelt die Geschäftsfähigkeit ihrer Mutter und geht gegen eine Testamentsänderung zugunsten der Mutter aus dem Jahr 2010 an. 2018 bestätigte ein gerichtlicher Gutachter die von der Tochter bezweifelte Testierfähigkeit des 2013 verstorbenen Konzerngründers Peter Dussmann. Das Verwirrspiel geht weiter.
Die Zukunft des 1825 gegründeten Heidenheimer Maschinenbauers Voith hing Anfang der 1990er Jahre am seidenen Faden. Die beiden Eigentümerstämme waren zerstritten. Während der eher anthroposophisch angehauchte Stamm Hanns Voith die unternehmerische Verantwortung weiterhin delegiert sehen wollte, forderte der eher unternehmerisch denkende Stamm Hermann Voith stärkere Teilhabe an der Macht. Mit dem Schweizer Konkurrenten Sulzer stand bereits ein Käufer vor der Tür. Der Gordische Knoten wurde mit einer klassischen Realteilung durchtrennt: Die Erben des Stammes Hanns Voith erhielten das Kerngeschäft rund um die heutige Voith GmbH & Co. KGaA. Dem andere Familien-Stamm, zu dem auch Dr. Robert Schuler-Voith gehört, der langjährige Mehrheitsaktionär der Schuler AG und Leifheit AG, fielen die Finanzbeteiligungen an Salamander, EllringKlinger, DEWB etc. zu.