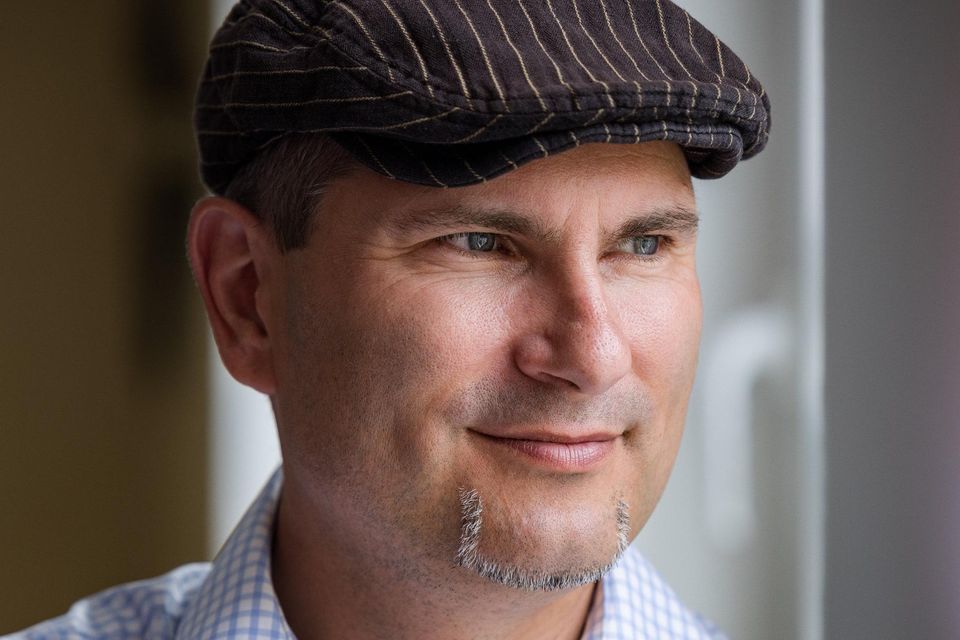Ich habe mich bisher nie sonderlich für Segeln interessiert. Seit letztem Monat hat sich das geändert, denn ich schaue von meiner Wohnung im sechsten Stock direkt auf das Segelrevier vor Barcelona, wo der 37. America’s Cup ausgetragen wird.
Mir wird hier unmittelbar und sehr unterhaltsam vor Augen geführt, wie das Matthäus-Prinzip funktioniert.
Ola, America’s Cup!
Den America’s Cup gibt es seit 1851. Er wird damit noch länger durchgeführt als die Olympischen Spiele der Neuzeit. Sie gelten zusammen als die ältesten Sportwettbewerbe der Welt. Deshalb hat die Austragung vor Ort für einen mächtigen Hype gesorgt: Barcelona ist die einzige Stadt, in der nun beide stattgefunden haben.
Das allein hätte mich wahrscheinlich noch nicht vom Hocker gerissen. Auch die Rennen live von oben zu verfolgen, ist im Grunde nicht prickelnd: So kann ich von hier aus weder die Winkel erkennen, in denen die Boote fahren, noch kann ich die Streckenbegrenzungen sehen. Deshalb kann ich oft kaum sagen, wer in Führung liegt oder wie weit es noch bis zum Ziel ist.
Nichts zu sehen!
Die Beobachtung der Sportler fällt weg, weil diese fast komplett im Boot versenkt sitzen. Das Strampeln der vier Radfahrer lässt sich zwar erahnen, die die Kraft für die Segelhydraulik erzeugen. Aber von dem, was die vier Segler machen, hat man mir zwar erzählt – doch sehen kann ich es nicht.
Was ich allerdings sehe, sind diese atemberaubenden Boote. Deren Anblick finde ich einfach irre. Ich beobachte sie nun schon ein paar Wochen, und die Faszination nimmt einfach nicht ab.
Zeit für Faszination
Allein, wie ruhig diese Boote bei voller Fahrt auf dem Wasser liegen. Denn eigentlich liegen sie gar nicht auf dem Wasser. Sie fliegen darüber hinweg. Einfach toll!
Was mich als Ingenieur an diesen Booten so beeindruckt: Schon kleinste Veränderungen an den Winkeln der Flügel können die Manövrierfähigkeit steigern, die „Flughöhe“ justieren oder für noch mehr Geschwindigkeit sorgen. Und die Geschwindigkeit ist jetzt schon enorm geworden. Bis zu 100 km/h. Auf dem Wasser!
Ich habe mir Youtube-Videos von alten Regatten des America’s Cup angesehen. Gegen heute waren diese Rennen wahrscheinlich für Segelenthusiasten interessanter – für mich waren sie sterbenslangweilig.
Keine Zeit für Kaffee
Sah man damals im Kurs die zwei Boote aufeinander zuhalten, konnte man sich noch ganz in Ruhe einen Kaffee aufgießen, bevor die sich kreuzten. Jetzt dauert es kaum zehn Sekunden, bis die aneinander vorbeischießen. Beim America’s Cup starten eindeutig die schnellsten, nicht Motor getriebenen Wassergefährte der Welt.
Es ist die Rede von Budgets von weit über 100 Mio. Dollar, die schon allein in die Teilnahme an den Ausscheidungsrennen fließen. Gewinnen werden Sie mit diesem Budget nicht. Finanziert werden die Entwicklung der Boote sowie die gesamte Veranstaltung nicht etwa durch Eintrittsgelder oder Übertragungsrechte. Alles lebt von Mäzenen und Sponsorengeldern. Der America’s Cup ist damit das Boot gewordene Matthäus-Prinzip.
Das Prinzip des Matthäus
In Matthäus 13, Vers 12 steht geschrieben: „Wer hat, dem wird gegeben werden.“ Im Volksmund klingt dieses Prinzip so: „Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen.“ Denn der America’s Cup wird ausschließlich angetrieben von dessen Mythos. Er hält das Spektakel am Laufen.
Das Prinzip dahinter ist an sich einfach: Der Mythos bringt Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit bringt Geld. Das Geld bringt die Möglichkeit, die Sportart weiterzuentwickeln und immer noch spektakulärer zu machen. Das wiederum befeuert den Mythos. So gesehen ist der America’s Cup ein Paradebeispiel für gelungene Markenführung.
Der Jünger des Matthäus
Von allein entwickelt, hält sich solch’ ein Mythos selten. Ich wette, es gibt jede Menge Sportveranstaltungen, die ebenfalls 100 Jahre alt sind und die keine Socke kennt. Ein Mythos braucht aktiven Antrieb.
So investierte Formel-1-Promoter Bernie Ecclestone die ersten zwei Jahrzehnte das Geld, das er verdiente, umgehend in Vorleistung für die Fernsehsender. Er sagte zum Beispiel zu ihnen: „Eine Kamera ins Rennauto einbauen, ist euch zu teuer? Kein Problem, ich übernehme das. Ich schenke euch die Bilder.“
Seine Annahme: Wenn es erst einmal spektakuläre Bilder von der Strecke gibt, werden die Übertragungspartner sie senden. Diese Bilder werden für mehr Zuschauer sorgen, mehr Sponsoren anlocken und alle werden mehr verdienen. Und im nächsten Jahr konnte er zu ihnen sagen: „Schenken werde ich euch diese Bilder nicht mehr. Wollt ihr sie trotzdem?“ Seine Annahme ist aufgegangen.
Vorsicht, Zeitgeist!
Neben viel Geduld und Geschick gehört aber sicher auch eine Portion Glück dazu, Alter in Mythos zu verwandeln und diesen Status zu konservieren. Denn bei aller konsequenter Fortführung kommt auch ein Mythos nicht um eine gewisse Anpassung an den Zeitgeist herum. Die Frage ist nur, wie stark diese Anpassung sein darf.
Die Entscheidung, ob zum Beispiel es die Macher der woken Kampagnen von Walt Disney oder Nike mit der Anpassung übertrieben haben, lässt sich wahrscheinlich erst in zehn Jahren fällen. Solche Mythos- oder Markenbildungsprozesse sind komplex und lassen sich schwer vorhersagen. Aber der America’s Cup zeigt, dass Geduld und Konsequenz sich auszahlen.
Herrlich, ein Spleen!
Die Veranstalter haben bewusst am Spleenigen dieses Wettbewerbs festgehalten – von der hässlichen Kanne als Wanderpokal bis zur Regel, dass der Cupverteidiger Austragungsort und Regeln für die nächste Regatta vorgeben darf. Das Spleenige ist ein wichtiger Teil der Faszination und lässt sich als Geschichte immer wieder erzählen.
Was dem America’s Cup darüber hinaus hilft, ist, dass mit jedem Rennen neue Geschichten entstehen. Ein Gründungsmythos wird umso wertvoller, je weiter er fortgeschrieben wird. Zu behaupten, dass jedes Markenunternehmen einfach nur die Story des America’s Cup nachmachen muss, wäre natürlich viel zu einfach. Aber vom Matthäus-Prinzip, das dahinter erkennbar ist, lässt sich schon etwas lernen – finde ich.
In der ersten Reihe
Mich jedenfalls fesselt diese Kombination aus Mythos und Hightech in diesen Tagen. Und egal, ob die Briten jetzt noch ihre Aufholjagd fortsetzen oder die Neuseeländer sich doch einen überlegenen Sieg sichern: Ich kann mir gut vorstellen, dass ich ab jetzt jedes Mal den America’s Cup anschauen, selbst wenn er nicht vor meiner Haustür stattfindet. Dann nutze ich eben den Livestream. Denn – unter uns – dort lässt sich das Geschehen eh viel besser verfolgen.