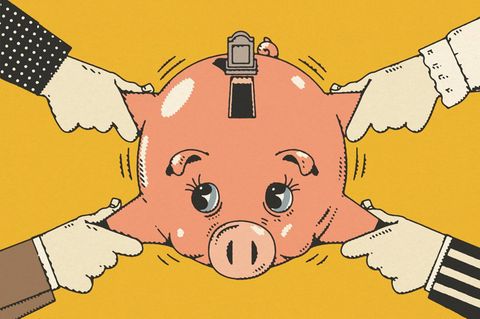Der Bischof von Würzburg begründete das Hexengeld mit dem Hinweis, dass die erhöhten Kosten der Hexenprozesse weder den Untertanen noch der fürstlichen Kanzlei zugemutet werden könnten (Mandat von 1627). Bei Hingerichteten ohne Familie wurde das ganze Vermögen konfisziert, bei Hexen und Zauberern mit Verwandten aufsteigender Linie verfiel die Hälfte der Güter dem Fiskus. Wo Kinder zurückblieben, wurde der fünfte Teil eingezogen. Die Kosten der Hinrichtung konnten auch von dem Freundeskreis der Hingerichteten, wie 1630 in Würzburg, eingefordert werden.
Das Amt des Hexenrichters galt als einträgliches Geschäft, da ein großer Teil seiner Besoldung, die ansonsten unregelmäßig war, aus den Strafgeldern resultierte. Den Henkern und Denunzianten kam neben dem Hexengeld auch aus den fürstlichen und städtischen Kassen reichlich Geld zugute.
Bislang in dieser Serie veröffentlicht:
- die Fräuleinsteuer
- die Tür- und Fenstersteuer
- die Bartsteuer
Unsere Beispiele stammen aus dem Buch „Von der Aufruhrsteuer bis zum Zehnten: Fiskalische Raffinessen aus 5000 Jahren“, das bei Springer Gabler erschienen. Der Autor Reiner Sahm ist Steuerberater und Geschäftsführer einer Steuerberatungsgesellschaft