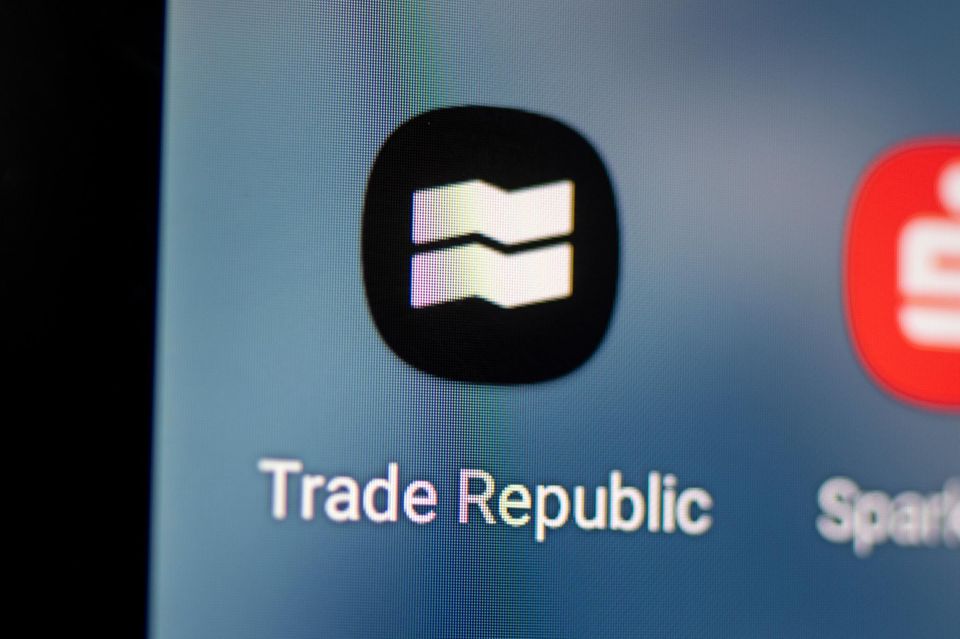Inhaltsverzeichnis
- Was wissen wir über die Großrazzia im Hafen von Piräus?
- Handelt es sich um einen Einzelfall bei Schmuggelware?
- Wie funktioniert das illegale Geschäftsmodell?
- Wie groß ist der wirtschaftliche Schaden für die EU?
- Wem gehört der Hafen von Piräus?
- Sind chinesische Unternehmen an weiteren Häfen in der EU beteiligt?
- Hat sich Europa durch den Verkauf von Hafenanlagen an chinesische Unternehmen angreifbar gemacht?
- Wie sollte die EU auf die Expansion chinesischer Unternehmen reagieren?
- Könnte man chinesische Beteiligungen an kritischer europäischer Infrastruktur rückabwickeln?
Der EU gelingt ein großer Schlag gegen den Warenschmuggel aus China. Im griechischen Hafen Piräus beschlagnahmen Ermittler Tausende Container mit unverzollter Kleidung, Schuhen und E-Bikes. Die Betrüger sollen seit mindestens acht Jahren falsche Angaben bei der Wareneinfuhr gemacht haben. Seit dem vergangenen Jahr hat die EU ihre Anstrengungen gegen illegale Warenimporte verstärkt. Hinter den kriminellen Netzwerken stehen chinesische Staatsbürger. Das bereitet der EU Sorgen. Denn chinesische Firmen sind nicht nur in Piräus am Hafen beteiligt.
Was wissen wir über die Großrazzia im Hafen von Piräus?
Laut der EU-Staatsanwaltschaft fand Ende Juni die bislang größte Container-Razzia in der Geschichte der Europäischen Union statt. Dabei beschlagnahmten die Ermittler über 2400 Container aus China. In den Containern befanden sich Waren wie Kleidung, Schuhe und Elektrofahrräder im Wert von 250 Millionen Euro. Ermittelt wird sowohl gegen private Akteure als auch gegen Zollbeamte.
Gegen sechs Personen wurde Anklage erhoben. Die Zollbetrüger sollen bereits seit mindestens acht Jahren im großen Stil falsche Angaben bei der Wareneinfuhr gemacht haben. Hinter dem Betrugsnetzwerk stehen maßgeblich chinesische Staatsbürger, wie es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft heißt. Sie sollen die Profite nach China überwiesen haben.
Handelt es sich um einen Einzelfall bei Schmuggelware?
„In dieser Größenordnung ist das bisher ein Einzelfall“, sagt Jens Bastian von der Stiftung Wissenschaft und Politik gegenüber ntv.de. Allerdings habe es bereits vergleichbare Fälle gegeben. Laut EU-Staatsanwaltschaft gab es im Rahmen der großangelegten Aktion „Calypso“, zu der auch die Razzia in Piräus zählt, eine Reihe von Einsätzen. Dabei ging es ebenfalls um die illegale Einfuhr von Waren wie Textilien, Schuhen, E-Bikes und E-Scootern aus China, die mit falschen oder manipulierten Zolldokumenten in die EU geschmuggelt werden sollten.
Bastian geht von einem „systematischen Betrugsmuster“ aus. Aus heutiger Sicht seien die Probleme absehbar gewesen, sagt der Ökonom, der zur Zeit der Schuldenkrise Mitglied der Taskforce der EU-Kommission für Griechenland war. Lange habe die Bereitschaft gefehlt, erkennbaren Problemen und Verdachtsfällen nachzugehen. Die griechischen Kontrolleure seien lange viel zu nachlässig gewesen. „Die griechische Politik hat viel zu lange eine Art 'Willkommenskultur' gegenüber den Chinesen gepflegt.“ „Kleinere“ Fälle, die vor der Operation Calypso auffielen, gab es in den Niederlanden mit dem „E-Bikes-Importbetrug“, in Italien mit dem Umsatz- und Steuerbetrug „Dragone“ und in Deutschland mit dem „Masquerade Ball„. Alle diese Fälle ereigneten sich innerhalb eines kurzen Zeitraums in den vergangenen beiden Jahren, was auf eine Zunahme der Betrugsfälle, aber auch auf eine höhere Priorisierung durch die Europäische Staatsanwaltschaft hinweist.
Wie funktioniert das illegale Geschäftsmodell?
Der Betrug besteht darin, dass für Waren aus China nur ein Bruchteil des tatsächlichen Warenwerts angegeben wird. Auf diese Weise werden Einfuhrzölle ebenso wie die Mehrwertsteuer umgangen. Im Fall von Piräus wurden nur zehn bis 15 Prozent des tatsächlichen Warenwerts angegeben. Die Razzien legen Schwachstellen in der Zoll- und Überwachungsstruktur der EU offen, insbesondere in Häfen wie Piräus, die sich in chinesischem Eigentum befinden. Offensichtlich können Containerströme im großen Stil manipuliert werden. Wenn europäische Behörden keinen vollständigen Zugriff oder Einfluss auf die Hafeninfrastruktur haben, wächst das Risiko von Schmuggel und illegalen Warenströmen.
Wie groß ist der wirtschaftliche Schaden für die EU?
Bislang hat der griechische Zoll in Piräus nur einen Teil der Container geöffnet. Der geschätzte Schaden über acht Jahre liegt bei etwa 800 Millionen Euro. Laut Ökonom Bastian ist „der politische und unternehmerische Reputationsschaden Chinas in Europa, nicht nur in Griechenland, noch größer“.
Wem gehört der Hafen von Piräus?
Die Mehrheit liegt beim chinesischen Staatskonzern Cosco Shipping. Die restlichen Anteile verteilen sich auf den griechischen Staat sowie auf private und kleinere institutionelle Anleger. Der Einstieg erfolgte schrittweise: Zunächst übernahm Cosco im Jahr 2009 den Betrieb zweier Containerterminals. 2016 kaufte der Konzern im Zuge der griechischen Privatisierungen 51 Prozent des Hafenbetreibers. Dieser Schritt war damals in Griechenland heftig umstritten. 2021 stockte Cosco seinen Anteil schließlich auf 67 Prozent auf.
Sind chinesische Unternehmen an weiteren Häfen in der EU beteiligt?
Ja. Derzeit sind chinesische Unternehmen an rund 30 Hafen-Terminals in der EU beteiligt. Dabei handelt es sich überwiegend um Minderheitsbeteiligungen oder Betriebskonzessionen. In einigen Fällen, wie in Piräus oder Zeebrugge, verfügen Konzerne wie Cosco oder Hutchison jedoch auch über eine Mehrheit. Damit haben staatlich kontrollierte Firmen aus China in den vergangenen 15 Jahren eine spürbare Präsenz in der europäischen Hafenlandschaft aufgebaut. Ein aktuelles Beispiel ist der Container-Terminal Tollerort (CTT) im Hamburger Hafen, an dem sich die chinesische Reederei Cosco im Juni 2023 mit 25 Prozent beteiligt hat.
Die chinesische Präsenz ist das Ergebnis der „Belt and Road Initiative“, Pekings globalem Infrastrukturprojekt zur Schaffung neuer Handelsrouten. In der Vergangenheit nutzten viele europäische Häfen, insbesondere in Südeuropa, Chinas Kapital für Modernisierung und Ausbau. Das brachte den EU-Häfen einerseits wirtschaftliche Vorteile, andererseits entstanden aber auch strategische Kontrollpunkte für China innerhalb der europäischen Lieferketten.
Hat sich Europa durch den Verkauf von Hafenanlagen an chinesische Unternehmen angreifbar gemacht?
„Die Entscheidung, den Hafen Piräus an die Chinesen zu verkaufen, war keine Entscheidung der EU, sondern eine der griechischen Regierung als Teil der Auflagen der damaligen Troika während der Rettungspolitik vor einer Dekade“, sagt Ökonom Bastian. „Cosco hatte keine ernsthaften europäischen Konkurrenten im damaligen Bieterverfahren.“ Heute wird die Expansion Chinas in Europa kritischer gesehen. Denn Investitionen wie die von Cosco in Piräus verschaffen China erheblichen Einfluss auf zentrale Logistikknotenpunkte. Es entstehen Abhängigkeiten, die in Krisen oder geopolitischen Konflikten problematisch werden können - und Schlupflöcher für systematischen Steuer- und Zollbetrug.
Wie sollte die EU auf die Expansion chinesischer Unternehmen reagieren?
Experten fordern eine deutlich strengere Kontrolle der Warenströme sowie eine bessere Zusammenarbeit der europäischen Zollbehörden. Piräus zeigt, dass es an wirksamer Überwachung bislang fehlt. „Die Kommission in Brüssel und die Regierung in Athen sollten genau hinschauen, wenn zukünftig Veräußerungen und Anteilsverkäufe an chinesische Firmen verhandelt werden“, so Bastian. „Hier geht es um rechtliche Auflagen, administrative Transparenz, eine klare Identifizierung der Geschäftsführung und regelmäßige Berichtspflichten. Das Beispiel Piräus zeigt, mit welcher kriminellen Energie vorgegangen wird. Neben der strafrechtlichen Klärung muss ebenso diskutiert werden, gegenüber chinesischen Firmen auch einmal klar Nein zu sagen!“
Die EU will das Screening-Verfahren für ausländische Investitionen weiterentwickeln, um kritische Infrastrukturen enger zu überwachen. Am 24. Januar 2024 hat die Europäische Kommission fünf Initiativen vorgestellt, mit denen die wirtschaftliche Sicherheit der Union gestärkt werden soll. Eine dieser Initiativen betrifft die Überarbeitung der Verordnung zur Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen (FDI).
Könnte man chinesische Beteiligungen an kritischer europäischer Infrastruktur rückabwickeln?
Bastian hält es - selbst wenn es rechtlich möglich wäre - für „nicht zielführend“. China sei in Griechenland und anderswo in Europa „sehr präsent und langfristig investiert“. Stattdessen sollte Cosco verpflichtet werden, vollumfänglich für Aufklärung zu sorgen. Andernfalls sollten die Betreiberlizenzen zurückgenommen werden. „Hier sind offenbar jahrelang systematisch rote Linien überschritten worden.“ Da Cosco in Piräus über 51 Prozent der Anteile kontrolliert, ist eine Enteignung praktisch und rechtlich kaum möglich.
Der Beitrag ist zuerst bei ntv.de erschienen. Das Nachrichtenportal gehört wie Capital zu RTL Deutschland.