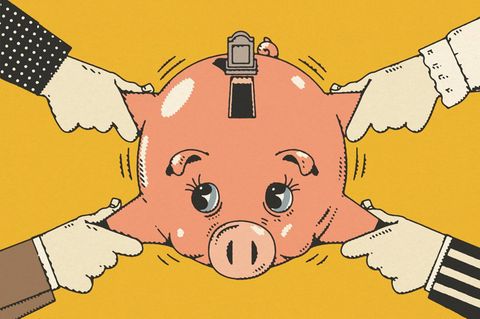Im Jahre 1798 wurde in Frankreich die Tür- und Fenstersteuer eingeführt. Diese sollte dazu dienen, auf indirektem Weg den Wert des Hauses zu besteuern. Steuerpflichtig waren dabei alle „Türen und Fenster, welche nach den Straßen, Höfen und Gärten der Gebäude und Fabriken hinausgehen“. Die Bemessungsgrundlage war sehr leicht von außen zu ermitteln, da die Ortsgröße, die Anzahl der Öffnungen und die weitere Ausstattung des Hauses ausschlaggebend waren. Es musste unterschieden werden, ob das Haus mit gewöhnlichen Toren versehen war und ob die Fenster sich in den unteren oder höheren Stockwerken befanden.
Wenn jemand in einer Ortschaft mit 20.000 Einwohnern lebte und ein Haus mit vier Öffnungen hatte, mussten 2,80 Franc entrichtet werden. Kam dazu noch ein Torweg oder ein Magazintor, so waren weitere 7,40 Franc, also insgesamt 10,20 Franc fällig. Kleinstädte waren begünstigt, in Großstädten war die Belastung erheblich höher. Kein Wunder, dass die Bürger Unannehmlichkeiten in Kauf nahmen und dem besteuerten Tatbestand auswichen: Es wurde mit möglichst wenigen Fenstern und Türen gebaut, auch wenn die Lebensqualität darunter litt
Unsere Beispiele stammen aus dem Buch „Von der Aufruhrsteuer bis zum Zehnten: Fiskalische Raffinessen aus 5000 Jahren“, das bei Springer Gabler erschienen. Der Autor Reiner Sahm ist Steuerberater und Geschäftsführer einer Steuerberatungsgesellschaft