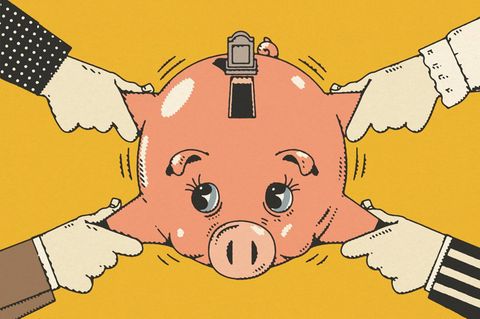Ursprünglich eine außerordentliche Steuer der Hintersassen von Grundherren, später eine von allen Untertanen geforderte landständische Steuer bei Vermählung einer Fürstentochter. Schon 1292 erhob Herzog Ludwig der Strenge von Bayern eine Brautsteuer für seine Tochter. München hatte im 15. Jh. mit der Fräuleinsteuer seinen Anteil an diesen außerordentlichen Steuern zu tragen. Um 1690 wurden Heiratsgelder erstmals auch den jüngeren Söhnen der lippischen Landesherren bewilligt.
1606 boten die Bürger von Saarbrücken und St. Johann für die als drückend empfundene Fräuleinsteuer dem Grafen Johann von Saarbrücken einen Vergleich an: zum jeweils fälligen Hellergeld – eine Abgabe auf den Wein in der Grafschaft Saarbrücken, um 1500 eingeführt – wollten sie zusätzlich einen weiteren Pfennig zahlen, wenn ihnen dadurch „Alle Beth, Hochzeitsgeld u. Reiswagen“ zukünftig erlassen bliebe. Trotz Annahme dieses Anerbietens wurden die Städte ab 1660 wieder mit 1.200 Gulden an Fräuleinsteuer belegt, welche sie innerhalb von vier Jahren aufzubringen hatten. Ein Weg aus dieser Misere bestand nur in Hessen bei „unstandesgemäß geachteten heiraten“; dann entfiel die dort geforderte Prinzessinnensteuer.
Unsere Beispiele stammen aus dem Buch „Von der Aufruhrsteuer bis zum Zehnten: Fiskalische Raffinessen aus 5000 Jahren“, das bei Springer Gabler erschienen. Der Autor Reiner Sahm ist Steuerberater und Geschäftsführer einer Steuerberatungsgesellschaft