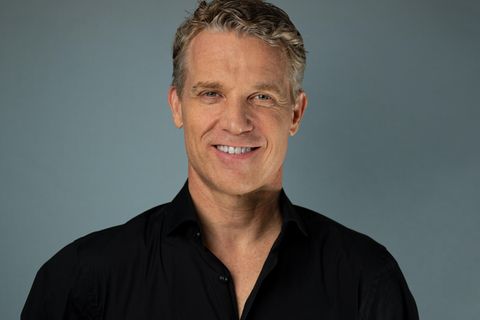Der zweitgrößte amerikanische Discounter Target bricht an der Börse ein, weil er in einer Pride-Bekleidungskollektion auch Kinder-T-Shirts anbietet. Bei Adidas zittern die Verantwortlichen, weil sie nach dem Kanye-West-Desaster mit ihren männliche Models in Badeanzügen schon die nächste Empörungswelle losgetreten haben. Der Disney-Konzern knabbert an schlechten Zahlen, während er Minnie Maus das Röckchen ausziehen und einen Hosenanzug anziehen lässt – als Zeichen des Fortschritts. Und der Absatz von „Bud Light“ sinkt schlagartig um 30 Prozent, nachdem der Brauereikonzern Anheuser-Busch InBev den transsexuellen Tiktok-Star Dylan Mulvaney für die Marke hat werben lassen.
In jüngster Zeit scheinen sich die Beispiele zu häufen, dass Unternehmen durch gut gemeinte moralische Auftritte massiven Schaden erleiden.
Go woke, go broke?
Der Spruch „Go woke, go broke“ macht immer häufiger die Runde. Ist es wirklich so einfach?
Mir ist der Spruch, ehrlich gesagt, zu platt, zu undifferenziert – er ist zu einem Kampfbegriff verkommen. Aber ich erkenne durchaus hinter all diesen Fällen einen Mechanismus, der für die betroffenen Unternehmen richtig gefährlich werden kann. Ein Mechanismus, der nicht nur in US-amerikanische Unternehmen wirkt. Er bedroht auch deutsche Firmen im tobenden Kulturkampf.
Eines noch vorweg: Aus der Tatsache, dass ich mir über die Tugendbotschaften von Führungskräften und Unternehmen Gedanken mache, mögen Sie bitte nicht schließen, was ich von dem jeweiligen moralischen Anliegen halte.
Kneel down or blame?
Ich erwähne das aus guten Grund: In moralisch aufgeheizten Debatten wird bei fehlender Zur-Schau-Stellung des Bekenntnisses zum „Guten“ oft reflexhaft eine Ablehnung in der Sache unterstellt. Erinnern Sie sich zum Beispiel an die Zeit, als Sportteams kollektiv vor einem Spiel niederknieten, um ihre Unterstützung für die „Black Lives Matter“-Bewegung zu demonstrieren? Die ersten Mannschaften, die zugunsten ihrer sportlichen Konzentrationsphase wieder auf den Kniefall verzichteten, wurden prompt als Rassisten angefeindet.
Also seien Sie versichert: Auch ich halte den Einsatz gegen jedwede Form von Diskriminierung oder zum Schutz der Umwelt für ein ehrenwertes, vertretbares Ziel. Und doch bezweifle ich, dass Unternehmen gut daran tun, sich solche Ziele zu weit oben auf die Fahnen zu schreiben. Denn lassen Sie uns schauen, was da wirklich passiert.
Aufmerksamkeit lenkt
Treten Führungskräfte in einer Organisation demonstrativ und wiederholt für eine Sache ein, erfüllen sie eine der wesentlichen Funktionen, die Führung hat: Sie lenken Aufmerksamkeit.
Das tun sie immer, sobald sie Ziele ausgeben, Projekte priorisieren oder Ressourcen zuteilen. Sie tun es aber auch, sobald sie sich (oder ihr Marketing) in die öffentliche Bresche werfen für tugendhaftes Handeln.
Damit geben Führungskräfte eine Blickrichtung vor und schaffen Orientierung, die wesentlich ist für das gemeinsame Handeln in einem Unternehmen.
Falls Sie nun einwenden mögen: „Ja, das ist doch genau richtig, wenn sich ein Unternehmen einer guten Sache verschreibt.“ So einfach erscheint mir das nicht. Führung geschieht immer unter der Bedingung von Knappheit, denn sonst braucht es sie nicht. Und unter dieser Knappheit greift ein Automatismus.
Aufmerksamkeit beschränkt
Wenn Sie als Führungskraft Ihre Aufmerksamkeit und die Ihres Unternehmens auf einen Aspekt richten, bekommen andere Aspekte automatisch weniger ab: weniger Aufmerksamkeit, weniger Ressourcen.
Das bedeutet, dass wenn Sie moralisch-politischen Aspekten – im Übrigen völlig egal, welcher ideologischen Richtung – den Vorrang vor den Belangen Ihrer Wertschöpfung geben, wird Ihnen das Unternehmen darin (bestenfalls) folgen. Ihr gemeinsamer Fokus liegt nur dann nicht mehr primär auf der Leistung des Unternehmens für den Kunden. Er liegt auf der Erfüllung des moralischen Anspruchs. Dahin fließen Zeit und Geld.
Würden Ihre Wettbewerber dasselbe tun wie Sie, bliebe Ihre Entscheidung vielleicht ohne Folgen. Doch wenn ich Ihnen eines garantieren kann: Das werden die nicht tun …
Aufmerksamkeit verschenkt
Die Folgen müssen nicht so schnell und so drastisch eintreten wie bei den genannten spektakulären Fällen. Viele dieser „Woke-Kampagnen“ hatten nachweislich auch nur kurz negative Auswirkungen auf das Unternehmensergebnis. Und manche Unternehmen sollen sogar etwas besser dastehen als zuvor. Ob dies wegen oder trotz der Kampagne geschah, ist letztlich nicht mit Gewissheit zu sagen.
Ist daraus zu schließen, dass es doch so etwas wie einen „Moralertrag“ gibt? Möglicherweise ja.
Möglicherweise haben sich die Unternehmen aber auch nur deshalb schnell erholt, weil sie ihre Kampagnen umgehend wieder gestoppt haben.
Welcher Erklärung Sie auch lieber Glauben schenken: Ich bin davon überzeugt, dass ein Unternehmen, das sich freiwillig tief politisiert – also über ein paar oberflächliche Marketingaktionen hinaus seine Aufmerksamkeit an politische, kulturelle oder moralische Ansprüche bindet –, früher oder später die negativen Folgen zu spüren bekommen wird. Es wird am Markt verlieren. Der Grund ist, dass es den existenziellen Fokus verloren hat, der ein Wirtschaftsunternehmen zu einem solchen macht: den auf die Wertschöpfung.
Ich sage nicht, dass ein Unternehmen sich nicht bemühen sollte, moralisch integer zu agieren. Doch wenn dies zu seinem Hauptanliegen wird, wenn es also seine Wertschöpfung gegen Tugendsignalisierung eintauscht, wird es verlieren.
Das hilft dem moralischen Anliegen dann auch nicht.
PS: Mit diesem Thema bin ich noch nicht ganz fertig. Denn wenn Führungskräfte und Unternehmen sich für eine moralisch gute Sache einsetzen, laufen sie nicht nur Gefahr, ihrem Unternehmen zu schaden. In vielen Fällen erweisen sie auch der Sache selbst einen Bärendienst. Warum das so ist und was das mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zu tun hat – darüber schreibe ich Ihnen in Kürze noch etwas, bevor ich mich Mitte Juli in eine längere Sommerpause verabschiede.