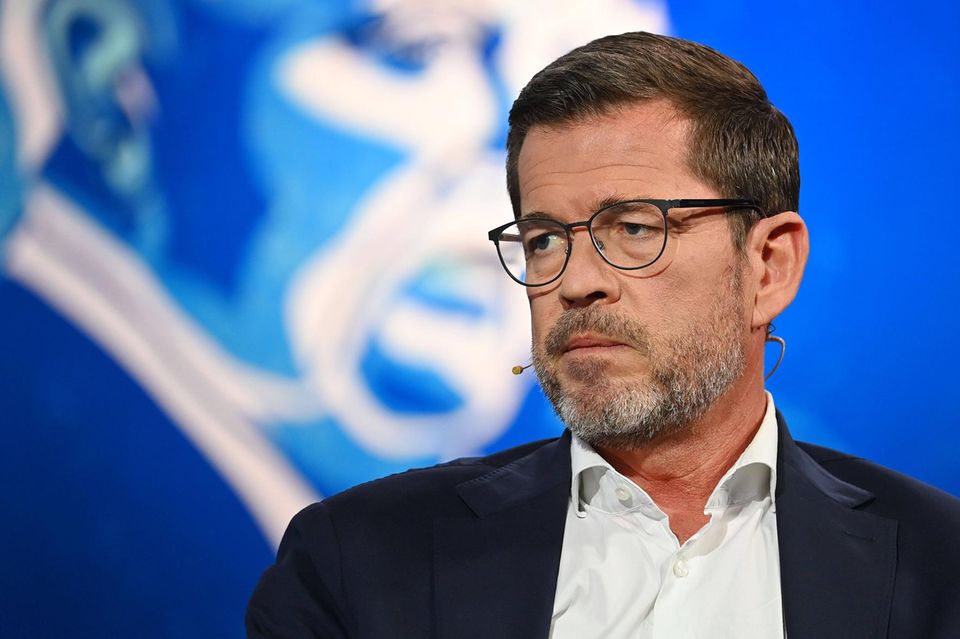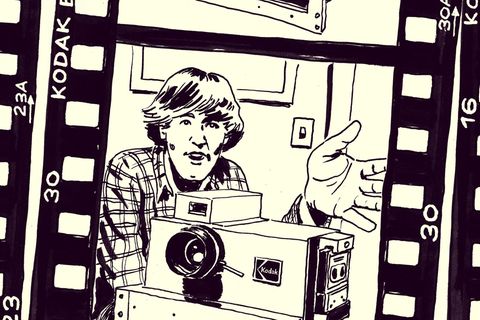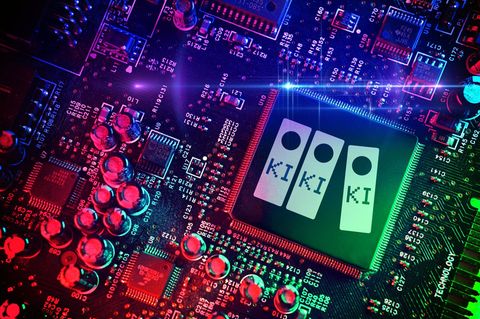Maren Urner ist Neurowissenschaftlerin und Journalistin. Anfang 2016 gründete sie Perspective Daily, das erste werbefreie Online-Magazin für konstruktiven Journalismus. In ihrem Buch „Schluss mit dem täglichen Weltuntergang“ warnt Urner vor den fatalen Auswirkungen der Informationsflut und der negativen Berichterstattung.
Capital: Welche Folgen hat die Informationsflut für uns als Individuum?
MAREN URNER: Für Individuen ist das eine komplette Überforderung auf biologischer Ebene. Unser Gehirn kommt nicht mehr hinterher, und das bedeutet, dass wir als Individuen auch nicht mehr hinterherkommen. Weil wir einfach die ganze Zeit, und das betrifft natürlich gerade den Online- und Digitalbereich, „verlockt“ werden zu klicken, zu swipen, zu gucken und zu hören. Und am besten alles gleichzeitig: Meistens nutzen wir gleich drei Geräte parallel. Aber das funktioniert nicht, weil unser Gehirn nicht so ausgerichtet ist. Aus biologischer Sicht können wir uns nur auf eine Sache konzentrieren und fokussieren. Multitasking ist ein Mythos. Wir glauben mehrere Dinge gleichzeitig zu machen, aber in Wirklichkeit ist das einfach ein sehr schnelles Wechseln zwischen verschiedenen Tätigkeiten. Jedes Mal wenn wir unsere Aufmerksamkeit oder Konzentration auf etwas Neues oder Anderes richten, weil wir zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her springen, kostet nicht nur die Aufgabe selbst, sondern auch das Wechseln unnötige Zeit und Energie. Wir müssen uns immer wieder neu reindenken und neu anfangen. Das heißt, ganz viel unserer Energieressource verschwenden wir darauf zwischen den einzelnen Aufgaben zu springen.
In Ihrem Buch „Schluss mit dem täglichen Weltuntergang“ schreiben Sie: Nachrichten sind stressiger als die Realität. Was ist das Problem des klassischen Journalismus?
Erschwerend zu der Informationsflut kommt hinzu, dass die meisten Inhalte sehr negativ sind. Die Medien haben mittlerweile eine regelrechte Perversion kreiert, weil unser Gehirn aus evolutionärer Sicht veranlagt ist eher auf negative Nachrichten oder Ereignisse zu reagieren. Denn eine potentielle Bedrohung ist gefährlicher als eine positive oder zukunftsorientierte Nachricht, wie damals im Steinzeitalter als der Säbelzahntiger vor der Höhle stand. Natürlich müssen wir heutzutage nicht immer Angst ums Überleben haben, aber es entsteht ein gewisser Grad an Stress mit entsprechenden körperlichen Reaktionen. Das Problem ist, dass der Säbelzahntiger der digitalen Moderne im Sekundentakt vor der Höhle steht. Das heißt, unser ganzes System hat keine Zeit mehr diese Stressreaktion zu verarbeiten, die automatisch dadurch kreiert wird. Dadurch entwickelt sich chronischer Stress. Das ist nicht gesund und fördert auch dauerhaft die Entwicklung von Krankheiten.
Welche Auswirkungen hat das auf die Gesellschaft?
Es geht hier nicht um Stress in der Definition „wir haben alle so viel zu tun“, sondern um echte körperliche und psychische Folgen, die nicht nur den Einzelnen betreffen, sondern sich auch auf gesellschaftlicher Ebene äußern. Menschen entwickeln dann entweder sogenannte Coping-Strategien, also Bewältigungsstrategien, um mit dem Stress, den ein Ereignis kreiert, klarzukommen oder Zynismus. Dann wird jede Möglichkeit, über die Zukunft zu reden, als lächerlich oder naiv abgetan. Und wenn wir nicht über unsere Zukunft nachdenken und reden wollen, was dann? Das Resultat ist eine schlecht informierte Gesellschaft. Wir sind an einem Punkt, an dem wir Zugriff auf so viele Informationen haben und noch nie so viele Menschen diese Informationen konsumieren konnten. Das bedeutet, wir müssten eigentlich die bestinformierte Gesellschaft sein, die wir jemals in der Geschichte der Menschheit hatten. Das Problem ist aber, wir nutzen diesen Vorteil nicht. Und genau da setzt meine lösungsorientierte Denke an: Wie können wir neue Tools und unser psychologisches Wissen effizient nutzen, um eine besser informierte Gesellschaft zu schaffen, die kein zu negatives Weltbild hat und in der sich die Menschen der Ohnmacht hingeben oder, weil sie den Stress nicht aushalten, zurückziehen und sich zunehmend mit banalen Tätigkeiten beschäftigen, die eben diesen Stress nicht kreieren. Das ist letztendlich auch Demokratie gefährdend beziehungsweise nicht fördernd, weil wir Menschen uns nicht mit den gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen, egal ob es um Bildung, unsere Arbeitskultur, die Umwelt oder generell unserer Zukunft geht. Das bedeutet, dass wir keine vernünftige Basis haben, um zum Beispiel Wahlen ausrichten zu können. Weil die Menschen ja gar nicht wissen, worum es inhaltlich gerade geht.
Müssen wir unseren Umgang mit Medien generell hinterfragen?
Ja, ich glaube, dass wir generell immer unser Tun hinterfragen sollten. Es ist immer eine gute Idee, die Dinge zu reflektieren: Was mache ich eigentlich und wie gehe ich damit um? Im Bezug auf die Medien spielt vor allem die Omnipräsenz eine große Rolle, die uns ja überhaupt keine Zeit mehr gibt, zu reflektieren und darüber nachzudenken. Wann haben wir denn noch informationsfreie Zeit? Wenn wir diese Verhaltensänderungen auf gesellschaftlicher Ebene anwenden wollen, müssen wir uns fragen wie sich unser Umgang mit Medien auf zukünftige Generationen auswirkt? Was für eine Lebensumgebung wollen wir bereitstellen? Welche Verhaltensänderung wollen wir vielleicht anstupsen oder erleichtern, um Menschen zu motivieren, ihr Tun zu hinterfragen, und sich dann im Idealfall auch anders zu verhalten?
Kann unreflektierter Konsum abhängig machen?
Ja, es gibt bereits Kliniken, in denen Internetabhängigkeit behandelt wird. Diese Abhängigkeit äußert sich mit den kompletten biologischen Mechanismen, die wir von anderen diagnostizierten Abhängigkeiten wie illegalen Drogen oder Zucker kennen: Es ist immer wieder dieser Kick, den der Konsum kreiert, der schließlich abhängig macht. Wir kennen das alle von den sozialen Medien: Wir können endlos durch neue News scrollen, kommen aber nie unten an. Jedes Mal wenn wir nachgucken, ob unser Post schon mehr Likes bekommen hat oder erfahren wollen, ob es neue Nachrichten oder Urlaubsfotos von Freunden gibt, kreieren wir diese Form der Abhängigkeit, weil wir nicht genug davon bekommen können. Unser Gehirn ist so programmiert, weil es ja erst einmal interessante Nachrichten oder positive Interaktion sind. Wir leben in einer Umwelt, die das Ganze überstrapaziert. Unser System kommt nicht mehr hinterher.
Wie können wir uns vor digitaler Vermüllung schützen?
Der erste Schritt ist ehrlich zu reflektieren: Wo stehe ich gerade, wie oft und in welchem Umfang nutze ich das Internet und Social Media, und was stört mich daran eigentlich? Und dann müssen wir ein Ziel formulieren: Was möchte ich ändern und wo will ich eigentlich hin? Wir müssen eine Medienhygiene entwickeln. Wir würden nicht aus einer schmutzigen Pfütze trinken, weil diese nicht unseren Hygienestandards entspricht und eine potenzielle Gefahr für unseren Magen darstellt. Aber wir müssen auch überprüfen was wir an unser Gehirn ranlassen. So wie wir also auch andere Hygienestandards für unseren Alltag entwickelt haben, zum Beispiel zweimal am Tag die Zähne zu putzen, müssen wir auch bestimmte Regeln für unseren digitalen Konsum entwickeln und Grenzen setzen, in dem wir Informations- oder Medien freie Zeiten etablieren oder an Situationen geknüpfte Verhaltensmuster entwickeln. Beispielsweise es zur Gewohnheit machen, unser Handy nicht zu nutzen, wenn wir mit Freunden unterwegs sind. Dann ist es wichtig unser Wissen, wie wir psychologisch und verhaltenstechnisch funktionieren, zu nutzen und aufzuklären. Viele Menschen wissen nicht, dass uns ein Smartphone schon ablenkt, wenn es sich nur in Sichtweite befindet. Egal ob es blinkt oder stumm geschaltet ist, allein die Anwesenheit sorgt dafür, dass ein bestimmter Teil unseres Gehirns sich damit beschäftigt – bewusst oder unbewusst. Denn es könnte ja sein, dass gleich etwas Spannendes passiert. Dabei verschwenden wir Energie, die wir effektiver nutzen können.
Inwiefern spielt kritisches Denken eine Rolle?
Wir können kritisches Denken auch als Reflexion bezeichnen, oder auch als intellektuelle Demut. Damit meine ich Demut vor dem eigenen Intellekt. Denn alles was wir wahrnehmen ist immer geprägt durch unsere subjektive Wahrnehmung und unsere subjektiven Erfahrungen, die wir bisher im Leben gemacht haben. Und dann gibt es verschiedene kognitive Verzerrungen, die sagen, dass wir Dinge, die in unser persönliches Weltbild leichter akzeptieren als wenn es Meinungen oder Fakten sind, die diesem nicht entsprechen. Die einzige Chance damit umzugehen ist, ist zu reflektieren und unsere automatisierten Reaktionen zu hinterfragen. In unserer Informationsgesellschaft ist kritisches Denken eine der wichtigsten Eigenschaften, die wir uns selbst und unseren Kindern beibringen müssen.
Was ist konstruktiver Journalismus? Und wie arbeitet Perspective Daily?
Der konstruktive und lösungsorientierte Ansatz, der auf die neurowissenschaftlichen und pyschologischen Erkenntnisse zurückgeht, ist auf alle Themenbereiche des Journalismus anwendbar. Zusätzlich zu den klassischen W-Fragen ergänzen wir bei Perspective Daily eine weitere wesentliche Frage: Was jetzt? Wie kann es weitergehen? Und das ist eine Frage, die nicht nur die journalistische Arbeit, sondern mittlerweile auch den ganzen Umgang mit Informationen und Medien im weitesten Sinne betrifft. In einer Gesellschaft, die sehr problemorientiert denkt, handelt und schreibt, ist das eine schwierige Aufgabe. Bei Perspective Daily zieht sich das lösungsorientierte Denken durch unseren gesamte Arbeitsweise: Gemeinsam arbeitet unser Team aus Entwicklern, Autoren und Designern daran, die technische und die inhaltliche Komponente anhand unseres psychologischen Wissens stetig zu optimieren, um den Lesern eine bessere Interaktion mit den Inhalten und so auch einen besseren Lerneffekt zu ermöglichen.