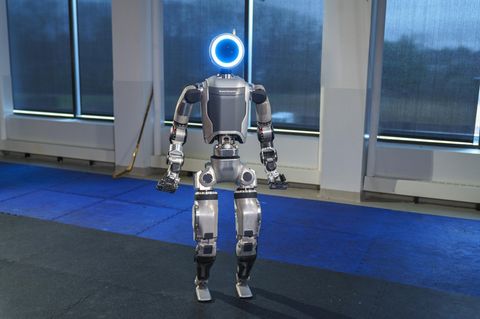Die Europäische Union beansprucht bei Klima- und Umweltpolitik eine internationale Führungsrolle und will die Grundlagen für eine neue grüne Wirtschaft schaffen. Dabei gibt es eine wichtige politische EU-Entscheidung, die dem Ganzen im Weg steht: die EU-Taxonomievorschriften. Greenpeace, Client Earth und WWF haben die EU-Kommission zu Recht verklagt, weil sie Gas und Atomkraft in ihrer Klassifizierung als nachhaltig einstufen.
Hinter dem sperrigen Begriff EU-Taxonomie verbirgt sich ein einfaches Prinzip: Anleger*innen sollen endlich Transparenz darüber erhalten, wie sich ihre Geldanlage ökologisch auswirkt. Leider setzt die Regulierung krasse Fehlanreize und behindert dringend notwendige Innovationen.
Mit der EU-Taxonomie können Anleger*innen ihre Investitionen im Sinne des Klima- und Umweltschutzes steuern. Alle, die ihr Geld anlegen, sollen endlich nachvollziehen können, wie sich ihre Investitionen auf Klimaschutz und andere Umweltfaktoren wie Wasser- und Meeresschutz, Kreislaufwirtschaft, Umweltverschmutzung sowie Biodiversität und Ökosysteme auswirken.
EU-Taxonomie setzt falsche Anreize
Aber es gibt ein großes Problem: Eine Analyse des Branchenverbands Cleantech for Europe zeigt, dass nur rund die Hälfte der Investitionen europäischer Climate-Tech-Fonds von der aktuellen Regelung der EU-Taxonomie als klimafreundlich anerkannt wird.
Ausgerechnet Gas und Atomkraft als angebliche Übergangstechnologien zu klima- und umweltfreundlicher Stromerzeugung werden von der EU-Taxonomie gefördert. Dabei werden bei jeder Kilowattstunde, die mit Gas erzeugt wird, 250 Gramm Klimagase freigesetzt – kaum weniger als bei Heizöl mit 319 Gramm. Dabei hat die fossile Industrie 2022 laut vorläufiger Schätzungen der Internationalen Energieagentur (IAE) so viele Subventionen erhalten wie noch nie: 1 Billion US-Dollar, fast doppelt so viel wie 2021.
Ein riesiger Lobbyapparat im Hintergrund hat zu dieser Entscheidung beigetragen: Laut einer Studie der NGO Reclaim Finance beschäftigen 189 Akteure 825 Lobbyist*innen und geben zwischen 71,4 und 86,6 Mio. Euro pro Jahr aus, um Einfluss auf EU-Entscheidungen zu nehmen. Das Ergebnis: Während Gas und Atomstrom nun als klimafreundlich gelten, bleiben einige der Investitionen mit dem größten Treibhausgas-Einsparpotenzial bei der EU-Taxonomie außen vor.
Ein Beispiel: Schon 2022 stellte eine BCG-Studie fest, dass es keinen effektiveren Klimaschutz gibt als Investitionen in pflanzlichen Fleischersatz. Doch die EU-Taxonomie ignoriert das – Investitionen in alternative, nicht-tierische Proteinprodukte gelten nicht als klimafreundlich. „Investitionen in diesem Segment haben die höchsten CO2-Einsparungen pro Dollar des investierten Kapitals aller Branchen“, heißt es in der BCG-Studie. Eine interne Untersuchung des World Fund, unterstützt durch die TU Berlin, bestätigt das: Jedes Kilogramm pflanzlicher Steak-Ersatz spart demnach etwa 69 Kilogramm CO2 ein. Das entspricht einer Emissionsverringerung um 91 Prozent im Vergleich zu Rindfleisch.
Neue Technologien sind notwendig
Beim Blick auf die EU-Taxonomie fällt grundsätzlich auf, wie wenig innovative Technologien dort berücksichtigt werden: Ein weiterer riesiger Sektor, der noch am Anfang der Dekarbonisierung steht, ist etwa das Heizen und Kühlen von Gebäuden. Dabei spielt schon heute künstliche Intelligenz eine Rolle, um den Energieverbrauch automatisiert zu steuern. Die smarte Steuerung kommerzieller Gebäude mit Hilfe von Software hat in Case Studies CO2-Emissionen um bis zu 40 Prozent gesenkt. Allein: Die Regeln der EU schließen Software aus, wie auch der Branchenverband Cleantech for Europe kritisiert.
Als klimafreundlich anerkannt werden vor allem solche Technologien, die bereits am Markt verfügbar sind und zweifellos CO2-Emission einsparen. Dazu gehören beispielsweise Wind- und Solarkraftwerke. Aber: Um die enorme Herausforderung der Dekarbonisierung unserer Weltwirtschaft bewältigen zu können, reicht die Technologie, die wir heute haben, nicht aus.
Natürlich brauchen wir weiterhin enorme Investitionen in existierende Lösungen wie Wind- und Solarkraftwerke. Aber wir brauchen darüber hinaus auch risikoreiche Investitionen in neue, innovative Technologien wie beispielsweise KI-Software und sogar potenziell disruptive Technologien wie Quantencomputer, denen Expert*innen gute Chancen zurechnen, zum Beispiel vollständig neuartige Stromspeichertechnologien hervorzubringen. Erst dann haben wir alle Puzzleteile für eine gelungene Energiewende und Dekarbonisierung unserer gesamten Weltwirtschaft zusammen.
Nach den Berechnungen des World Funds haben Quantencomputer das Potenzial 600 Millionen Tonnen CO2-Emissionen jährlich einzusparen. Auch McKinsey hat das Potenzial erkannt und geht davon aus, dass Quantencomputer dazu beitragen könnten, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens doch noch zu erreichen.
Die EU braucht eine innovationsfreundliche Regulierung
Die Notwendigkeit innovativer Technologien zur Bekämpfung des Klimawandels bestätigt auch eine Untersuchung der Internationalen Energie-Agentur. „Fast die Hälfte der Emissionssenkungen, die erforderlich sind, um uns bis 2050 auf einen Netto-Null-Pfad zu bringen, müssen möglicherweise von Technologien kommen, die noch nicht auf dem Markt sind“, schreibt die OECD-Organisation. Die IAE fordert daher globale Anstrengungen, insbesondere neue Technologien und Innovationen zu fördern. Genau das aber verhindert die aktuelle EU-Regulierung.
Statt starrer Regeln und Kategorien, welche Investitionen Klima und Umwelt schützen, sollte die EU daher lieber auf eine innovationsfreundliche Regulierung setzen: Fonds aller Art müssen künftig ohnehin Nachhaltigkeitsexpert*innen beschäftigen. Diese sollten von Fall zu Fall entscheiden, welche Investitionen klimafreundlich sind und welche nicht – und diese Entscheidungen dann von unabhängigen Aufsichtsbehörden überprüft werden. Es gilt, flexibel und innovationsfördernd zu sein, denn ohne neue Technologien werden wir die Klimakrise nicht bewältigen können.