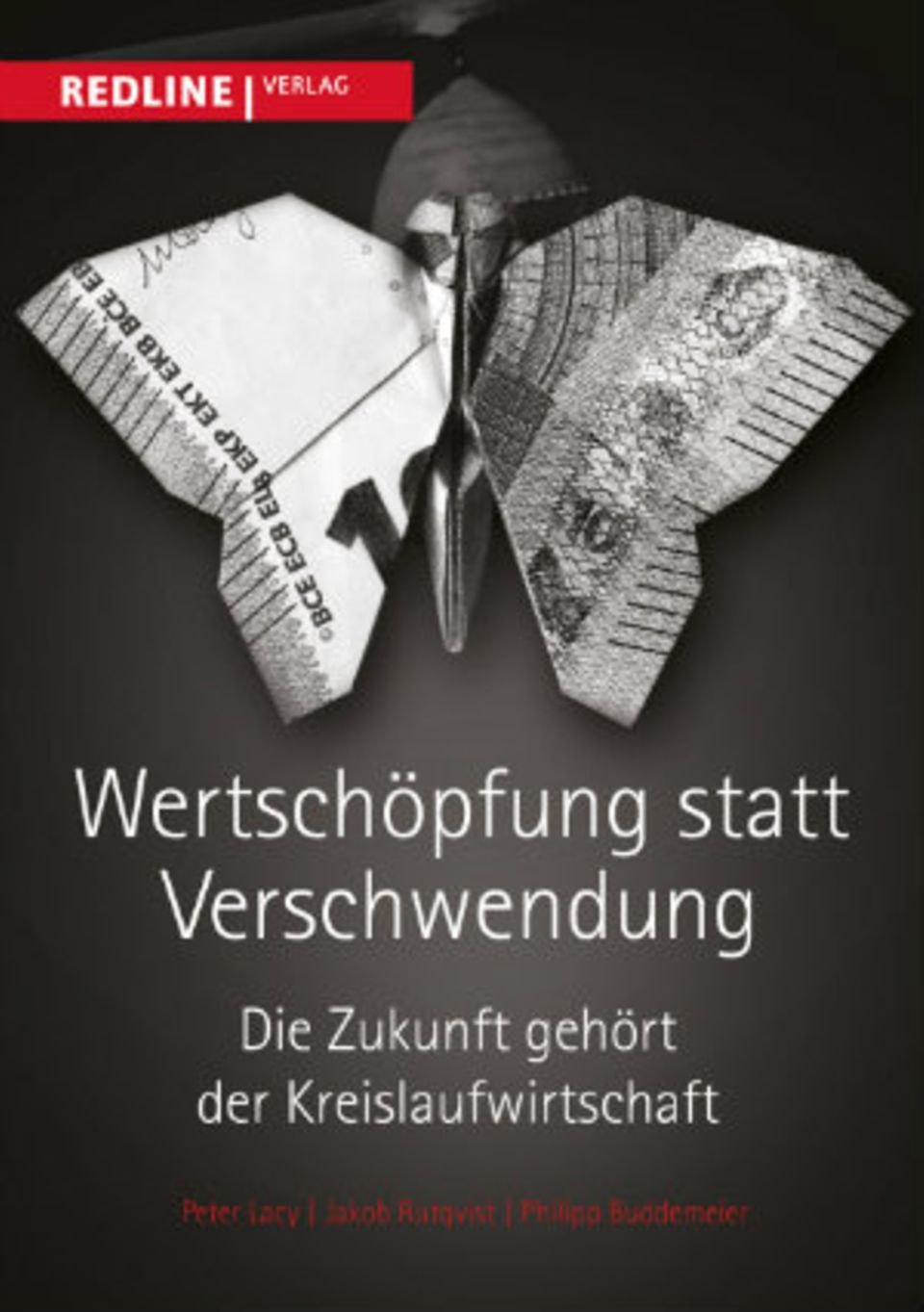Philipp Buddemeier ist Senior Manager bei Accenture Strategy und Co-Autor des Buches „Wertschöpfung statt Verschwendung“, das im Redline Verlag erschienen ist.
Ein Auto wird durchschnittlich 90 Prozent der Zeit nicht bewegt, die typische Bohrmaschine ist im Laufe ihres gesamten Lebenszyklus für gerade einmal 30 Minuten im Einsatz. Zwar ist allgemein bekannt, dass die Verschwendung natürlicher Ressourcen unsere Umwelt an ihre Grenzen führt – doch wem ist heute bewusst, dass die Entwicklungsrate sowie die Art und Weise unseres Konsums auch das Wirtschaftswachstum abwürgen wird? Bis zu 22 Billionen Euro an weltwirtschaftlichem Wachstum könnten bis zum Jahr 2050 verspielt werden, wenn wir die Beziehung zwischen natürlichen Ressourcen, ihrer Nachfrage und den Marktmechanismen nicht verändern.
Mittels radikal neuer Geschäftsmodelle und Technologien entwickeln sich heute neue Unternehmen und generieren Werte aus Ressourcen, Produktionsmitteln und Produkten, die bisher kaum genutzt oder nicht völlig ausgelastet werden. Ja, die Kreislaufwirtschaft in der einfachen Form gibt es schon. Doch wenn wir das Wirtschaftswachstum von der derzeit noch zunehmenden Nutzung der natürlichen Ressourcen entkoppeln wollen, dann müssen wir deutlich mehr tun als heute und eine richtige „Circular Economy“ – Kreislaufwirtschaft – entwickeln.
Das lineare Wirtschaftsmodell wird unberechenbar
Zwischen den 1960er und Anfang der 2000er-Jahre haben sich die Unternehmen an rückläufige Rohstoffpreise gewöhnt – trotz starken Wachstums. Doch seit der Jahrtausendwende gilt dieses Muster nicht mehr: Die zunehmende Urbanisierung und der Anstieg des Konsums der global wachsenden Mittelschichten führten zur deutlichen Verknappung vieler Ressourcen. Sauberes Wasser und fruchtbare Böden wurden vielerorts sogar Mangelware. Zudem sind in den vergangenen Jahren die Rohstoffpreise sprunghaft gestiegen, um dann wieder dramatisch abzustürzen. Somit wird das Ressourcenangebot immer unberechenbarer bei steigender Volatilität der Preise – das ist Gift für Unternehmen.
Durch Verschwendung haben sich die Preise für Metalle wie Kupfer, Eisen, Zinn und Nickel zwischen 2000 und 2015 nahezu verdoppelt; der reale Ölpreis lag im August 2015 immerhin 55 Prozent höher als im August 2000. Folglich müssen die Unternehmen schmalere Margen in Kauf nehmen, die höheren Kosten an ihre Kunden weitergeben, Effizienzoffensiven starten oder umstrittene Innovationen wie Schiefergas nutzen. Aber selbst dann wird unser lineares Wegwerfmodell bis zum Jahr 2030 unweigerlich zu einem Defizit von mehr als 8 Milliarden Tonnen an natürlichen Ressourcen führen. Dies entspricht 4 Billionen Euro entgangenen Wachstums oder dem gesamten jährlichen Ressourcenverbrauch der USA.
Alle Dimensionen betrachten
Die „Circular Economy“ befasst sich nicht mehr nur mit Recycling und Entsorgung von Rest- beziehungsweise Schadstoffen, dem sogenannten Abfall. Dies ist nur eine Sicht. Vier Perspektiven helfen Reststoffe als Chance und als weiternutzbare Ressource zu sehen:
• Welche Möglichkeiten gibt es nicht erneuerbare Ressourcen durch erneuerbare oder erneut nutzbare Ressourcen zu ersetzen?
• Wie lässt sich die Auslastung erhöhen, die heute verschwendet wird? So bleiben beispielsweise 60 Prozent der Lkw-Kapazität in Europa ungenutzt.
• Wie lässt sich die Nutzungsdauer verlängern, die heute oft unnötig kurz ist, zum Beispiel durch besseres Design, Reparatur und Wiederaufbereitung?
• Wie lässt sich aus ausrangierten Gütern noch etwas Werthaltiges gewinnen?
Verschwendung ist tief im linearen Wirtschaftsmodell verankert und es ist häufig schwierig den Wert von (Rest)-Stoffen zu begreifen. Es ist deshalb nicht einfach umzusteuern. Die Geschäftsmodelle der „Circular Economy“ verlangen umfassende Veränderungen in Denkweise, Organisation und Strategie, gerade wenn sie in großem Maßstab umgesetzt werden. Pioniere der „Circular Economy“ können aber viel gewinnen. Caterpillar beispielsweise spart viel Geld und bis zu 90 Prozent des Energieverbrauchs durch die Wiederaufbereitung von Millionen Bauteilen pro Jahr – diese Betriebstätigkeit ist rentabel und beschäftigt mehr als 4000 Mitarbeiter.
Start-ups als Vorreiter, doch Großunternehmen ziehen nach
Großunternehmen wie Caterpillar gelten im Kontext der „Circular Economy“ eher als Ausnahme. Vor dem Hintergrund des erforderlichen Paradigmenwechsels überrascht es kaum, dass es sich bei vielen Pionieren, die den Circular Advantage bereits für sich nutzen können, um unabhängige Start-ups handelt, die frei sind vom linearen Denken. Besonders wichtig ist dies für die Sharing Economy, in der Unternehmen wie Airbnb und Uber Angebot und Nachfrage zusammenbringen, um freie Kapazitäten bestehender Produktionsmittel zu nutzen.
Natürlich sind auch traditionelle Unternehmen inzwischen auf der Suche nach radikalen Strategien zur Neuorientierung. Einige wandeln sich vom Güteranbieter zum Serviceunternehmen. Sie bieten Mobilität oder Betriebszeit statt Lastwagen oder Maschinen. Dieser Wandel von einem Vertriebsmodell für Güter zu einem Betriebsmodell mit gleichzeitiger Eigentümerschaft der Güter veranlasst die Unternehmen wiederum dazu, zuverlässigere und langlebigere Produkte zu entwerfen. Beispielsweise verkauft Philips „Beleuchtung als Dienstleistung“, also nicht die LED-Leuchten selbst, sondern deren Nutzung – und erzeugt damit einen anderen Kundennutzen.
Die vermutlich herausforderndsten Geschäftsmodelle der Kreislaufwirtschaft transformieren die Lieferkette, verlängern die Lebensdauer der Produkte oder verwenden Reststoffe und Materialien auf neue Weise wieder. Beim Urban Farming zum Beispiel werden Pflanzen gestapelt und mit Nebel bewässert – unter Nutzung von LED-Beleuchtung, um die Erträge mit einem Bruchteil des Platzes und der Ressourcen zu steigern, die in der traditionellen Landwirtschaft erforderlich wären.
Die neuen Geschäftsmodelle erfordern ein ganz anderes Design, andere Prozesse und eine andere Kommunikation zwischen Lieferanten und Kunden. Doch die Vorteile sind oft frappierend und beschränken sich nicht nur auf geringere Kosten und eine höhere Ressourcenproduktivität sondern erhöhen auch die Zuverlässigkeit der Lieferkette; etwas, über das so manches Unternehmen die Kontrolle verloren hat. Zugleich wird die Differenzierung von Marken und Produkten ermöglicht.
Technologie und Politik sind wichtige Antriebskräfte
Viele „Circular Economy“-Ansätze hängen von neuen Technologien ab – von der Materialwissenschaft über mobile Anwendungen und Cloud Computing bis hin zur Datenanalyse. In der Tat ist die Fähigkeit, Daten zu nutzen, um Ressourcen über die Wertschöpfungskette hinweg zu verwalten, das Herzstück der erfolgreichsten neuen Geschäftsmodelle. Erste Unternehmen, die hier bescheidene Fortschritte gemacht haben, machen die Kreislaufwirtschaft aber noch nicht ansatzweise zum Mainstream.
Auch die Politik wird eine wichtigere Rolle spielen. Die Regulierung der Umweltstandards nimmt weiter zu, was die Beschaffung und Nutzung von natürlichen Ressourcen, den Betrieb sowie den Umgang mit den Rest- und Schadstoffen angeht. Doch um die Inhaltsstoffe der Produkte transparenter zu machen und Ansätze für deren Wiederverwendung zu setzen, sind noch weitere Schritte erforderlich. Vor allem sollte die Politik einen Schritt zurücktreten und erkennen, dass die „Circular Economy“ auf das Fundament des heutigen linearen Wirtschaftsmodells gesetzt werden muss, um es dann abzulösen.
Die Umweltschäden der Industrie werden mittlerweile weltweit ernst genommen. Zugleich stellen die wirtschaftlichen Chancen der Kreislaufwirtschaft einen attraktiven Anreiz für Unternehmen dar, um verantwortungsvoller mit unseren natürlichen Ressourcen umzugehen. Wenn wir die Circular Economy erblühen lassen, erarbeiten wir uns allen eine 22 Billionen-Euro-Chance.
Foto: Friends of Europe / (CC BY 2.0)