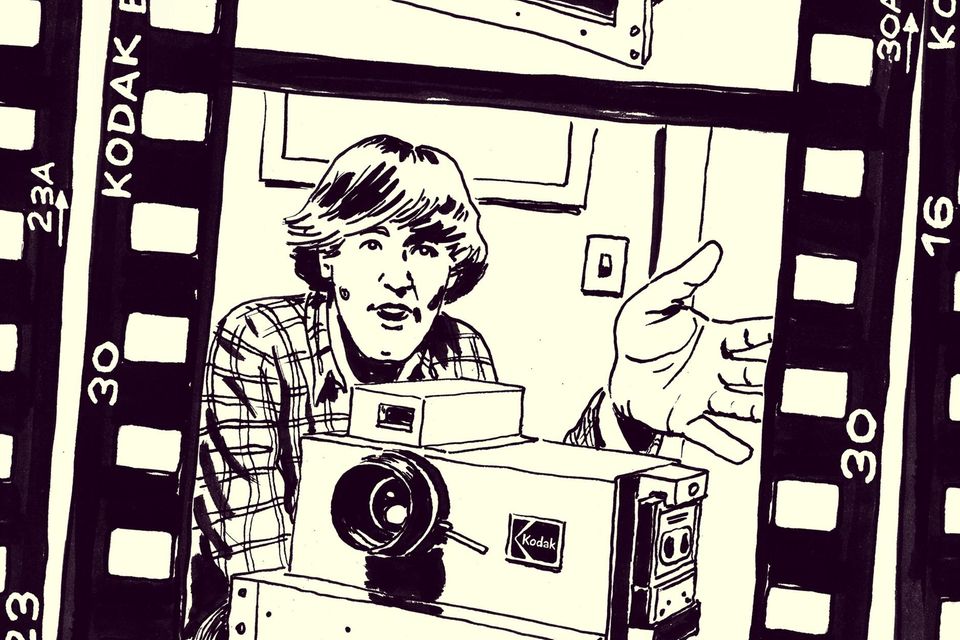Bye-bye Steuerparadies? Staaten entgehen jährlich Milliarden an Einnahmen, weil Großkonzerne bei der Steuer tricksen. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Ab diesem Jahr unterliegen international tätige Unternehmen einer globalen Mindeststeuer von 15 Prozent. Diese zahlen sie auf ihre Gewinne – egal wo auf der Welt sie tätig sind und wo sie diese Gewinne erwirtschaften. Der erste Teil dieser Steuerreform ist Anfang Januar fast unbemerkt in Kraft getreten und soll mehr Steuergerechtigkeit und fairen Wettbewerb bringen, indem Steuervermeidung durch große Konzerne unterbunden und Steueroasen trockengelegt werden.
Konzerne vermeiden Steuern durch Gewinnverschiebung
Bislang haben multinationale Unternehmen die Möglichkeit, ihre Gewinne zwischen verschiedenen Ländern hin- und herzuschieben. Sie gestalten ihre Steuern zum Beispiel, indem zusammengehörige Konzerngesellschaften untereinander handeln: Eine Gesellschaft sitzt in einem Land mit niedrigem Steuersatz und hält die Lizenzen an Markennamen, Patenten oder anderen Rechten. Verbundene Konzerngesellschaften, die in Staaten mit hohen Steuern angesiedelt sind, können die Markenrechte zwar nutzen, müssen dafür aber teure Lizenzgebühren zahlen.
Diese setzen sie anschließend als Betriebsausgabe ab. So kann der Mutterkonzern die Gewinne von Gesellschaften in Staaten mit hohen Steuersätzen kleinrechnen und die Gewinne in Länder überführen, wo sie geringeren Steuern unterliegen. Auf diese Weise entgehen Staaten mit durchschnittlichen oder höheren Unternehmensteuern jährlich Milliardengelder.
Bis zu 800 deutsche Firmen müssen zahlen
Künftig müssen global agierende Unternehmen sämtliche Gewinne, die sie weltweit erwirtschaften, mit mindestens 15 Prozent versteuern. Es soll keine Rolle mehr spielen, welche Steuervergünstigungen einzelne Staaten gewähren und welche Steuersparmodelle Firmen konzipiert haben. Das Gesetz verpflichtet Konzerne, gegebenenfalls zu Hause nachzuversteuern:
Zahlt ein multinationales Unternehmen in einem Land etwa nur 8 Prozent Steuern, greifen die neuen Regeln. Das Heimatland des Konzerns darf die Differenz bis zum neuen Mindestsatz nachfordern – hier 7 Prozent. Die Mindestbesteuerung soll es für Firmen unattraktiv machen, Gewinne zwischen Standorten zu verschieben. Niedrige Unternehmenssteuersätze sollen damit kein ausschlaggebender Standortfaktor mehr sein.
Gegenüber den Finanzämtern müssen sich künftig internationale Großkonzerne mit Jahresumsätzen von mehr als 750 Mio. Euro erklären. Weltweit fallen zirka 8000 Firmen unter die Regelung, darunter voraussichtlich 600 bis 800 deutsche Unternehmen.
Bis zu 1,7 Mrd. Euro Mehreinnahmen für Deutschland
Weltweit könnte die Mindeststeuer zusätzliche Einnahmen in Höhe von 220 Mrd. US-Dollar generieren, so EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni in einer Mitteilung der Europäischen Kommission.
Wie viel mehr Steuern Deutschland durch die Reform erwarten kann, hat das Ifo Institut im Auftrag des Bundesfinanzministerium geschätzt. Die Experten rechnen zwischen 2024 und 2026 mit mittelbaren Mehreinnahmen in Höhe von 1,5 bis 1,7 Mrd. Euro pro Jahr – vorausgesetzt das neue Gesetz halte Konzerne tatsächlich davon ab, Gewinne von einem Staat in den anderen zu verlagern. Damit bleiben die Erwartungen hinter früheren Schätzungen zurück.
Ob und in welcher Höhe Deutschland unmittelbar zusätzliche Steuereinnahmen erzielen kann, hänge laut Ifo Institut auch davon ab, wie Steueroasen auf die Einführung der Mindeststeuer reagieren. Sollten sie ihre Steuern erhöhen, könnten sie das Aufkommen aus der Mindestbesteuerung selbst einstreichen. Länder mit höheren Steuern könnten dann leer ausgehen.
Trotzdem halten Expertinnen und Experten die Einführug der neuen Steuer grundsätzlich für sinnvoll. „Die Mindeststeuer ist ein guter erster Schritt in Richtung Steuergerechtigkeit“, sagt Wirtschaftswissenschaftlerin Samina Sultan vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) zu Capital. „Wir sehen bereits erste Länder wie Irland, die reagieren und ihren Steuersatz anheben.“
Zweiter Teil der Reform in Arbeit: Google und Amazon betroffen
Mit der Mindeststeuer startet die erste von zwei Reformsäulen. Mit einer entsprechenden EU-Richtlinie hatten sich die EU-Länder dazu verpflichtet, die Mindeststeuer bis Ende 2023 in nationalem Recht zu verankern. Dem ist die Bundesregierung mit dem neuen Gesetz rechtzeitig gefolgt. Der Großteil der am Projekt beteiligten Länder muss dagegen noch nachziehen.
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) feilt derweil am zweiten Teil der Reform. Dabei geraten vor allem Techriesen wie Google und Amazon in den Blick. Sie können zum Beispiel durch Einnahmen aus Werbeklicks und dem Handel mit Daten hohe Gewinne in Ländern generieren, ohne tatsächlich vor Ort zu sein.
Bislang zahlen sie darauf selten Steuern, denn die Besteuerung von international agierenden Unternehmen ist überwiegend national organisiert. Konzerne müssen in der Regel nur dort Unternehmensteuern zahlen, wo sie ansässig sind. Hier setzen die OECD und die reformbeteiligten Länder an. Sie arbeiten an einem Konzept, das die Besteuerungsrechte zwischen den Staaten neu verteilt und Unternehmen dort zu Steuern verdonnert, wo sie auch die Gewinne erwirtschaften.
Netzwerk Steuergerechtigkeit: „Ziel noch lange nicht erreicht“
„Das ursprüngliche Ziel, dass die großen Konzerne einen fairen Teil ihrer Gewinne abgeben und das auch in den Zielländern wie Deutschland und noch mehr im globalen Süden tun, ist aus unserer Sicht noch lange nicht erreicht“, sagt Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. „Zusätzliche Steuereinnahmen von den großen Digitalkonzernen erhält Deutschland erst mit dem zweiten Teil der Reform. Ob der umgesetzt wird, steht aktuell aber noch in den Sternen.“
Unter der Leitung der OECD und den G20-Staaten arbeiten mittlerweile 145 Staaten gemeinsam international verbindliche Mindeststandards und Regeln für die Besteuerung multinationaler Unternehmensgruppen aus. Beteiligt sind neben Deutschland alle weiteren EU-Länder und große Volkswirtschaften wie die USA, China, Japan, Indien, Großbritannien, Kanada, Brasilien und Australien. Selbst bei Steuervermeidern beliebte Länder wie die Schweiz, Barbados oder die Cayman Islands stehen auf der Teilnehmerliste und beteiligen sich.