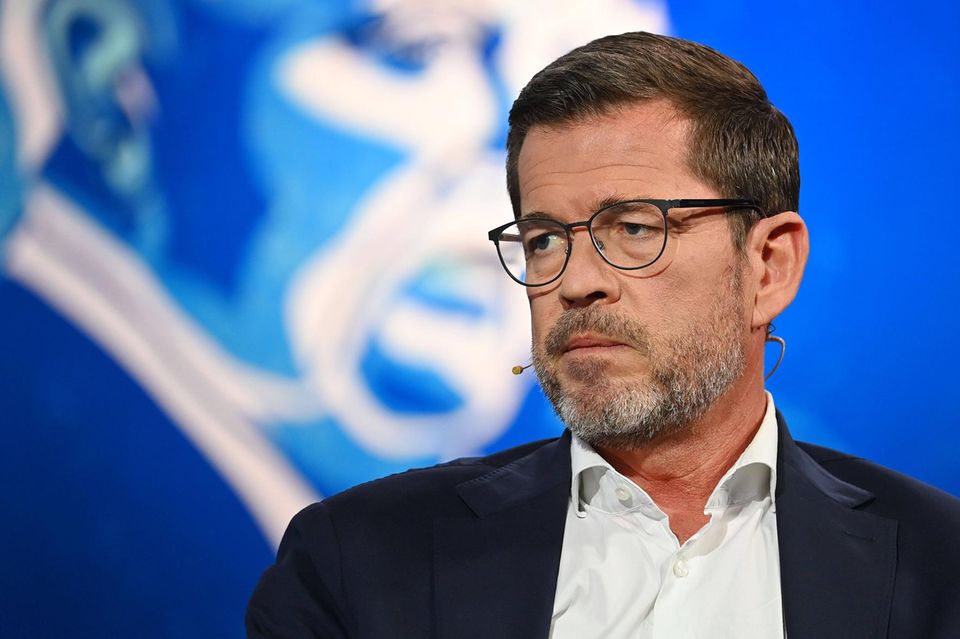Das politische „Nein“ zur Kohle ist nun da. Zumindest auf Bundesebene scheint beschlossen, dass die Kohleindustrie ein Auslaufmodell ist. Vorerst die Braunkohle. Derweil hielt ja die Wirtschaft – in Gestalt von Siemens-Chef Joe Kaeser – erst vor zwei Tagen ausdrücklich an der Branche fest. Die Zulieferung für ein Kohlebergwerk in Australien sei ein zu wichtiges Geschäft für Siemens, entschied er. Der Konzern werde an dem Deal festhalten und seine „vertraglichen Verpflichtungen erfüllen“. Ungeachtet der Proteste von Klimaaktivisten. Doch zumindest die Politik will die Kohle als Energieträger nun per Gesetz stoppen. Das soll Mitte des Jahres verabschiedet werden.
Bereits vor einem Jahr verständigte sich die von der Bundesregierung eingesetzte Kohlekommission auf den Ausstieg aus dem Braunkohletagebau und die Abschaltung von Kohlekraftwerken. In dieser Woche stimmten auch die Ministerpräsidenten der betroffenen Bundesländer zu, ebenso wie die Bundesminister für Wirtschaft, Umwelt und Finanzen. Der Ausstieg soll zwar „sofort beginnen“, aber erst 2038 werden die letzten Kohlekraftwerke stillgelegt. Überdies müssen noch die Betreiber der Kraftwerke und Tagebaue endgültig zustimmen. Und die Beteiligten müssen sich noch über die Finanzen und Ausgleichszahlungen einigen. Es bleibt also noch einiges zu regeln, bevor die Branche abgewickelt werden kann.
Kohleindustrie ist einer der größten CO2-Emittenten
Der Ausstieg aus der Kohle wäre aber immerhin ein großer Gewinn – nicht nur fürs Klima. Sondern er würde sich auch für Anleger auszahlen. Zudem muss kein Privatanleger bis 2038 warten, sondern er kann auch bereits heute etwas dafür tun, dass die Kohle bald Geschichte ist. Wie das?
Die größten Kohleunternehmen der Welt – das ist Fakt – tragen erheblich zum globalen CO2-Ausstoß bei. Allein die Energiekonzerne, Rohstoffunternehmen und die Versorger produzieren von allen Unternehmen im MSCI World Index rund 70 Prozent der CO2-Emissionen, obwohl sie im Index zusammen nur rund 15 Prozent der Wirtschaftsleistung ausmachen, wie die Ratingagentur Morningstar feststellt. Würde man also die Kohleindustrie zurückdrängen, blieben der Welt Millionen Tonnen CO2 jährlich erspart.
Coal India, Adani Enterprises und China Shenhua Energy sind nun laut der Gesellschaft Fossil Free Indexes die größten börsennotierten Kohleunternehmen nach CO2-Ausstoß, an denen sich private Investoren beteiligen können. Ebenfalls Großverursacher von CO2 sind demnach die großen Gasfirmen wie Gazprom oder Rosneft. Warum Fossil Free Indexes sie jährlich in seinen Listen aufführt? Damit Großanleger und Investmentfirmen aufhören, ihre Aktien zu kaufen und sie auch nicht mehr in Indizes aufnehmen.
Genau das nämlich gehört für viele Finanzmarktakteure inzwischen zur Geschäftsphilosophie, und zwar längst nicht nur für die ausgewiesenen Konstrukteure von Nachhaltigkeitsindizes und jene Investmentgesellschaften, die Öko- oder ESG-Fonds auflegen. Letztere tun es sowieso. In Frankreich zum Beispiel müssen institutionelle Investoren schon von Gesetzes wegen berichten, wie groß der CO2-Fußabdruck ihrer Produkte ist. Das errechnet sich aus dem Gesamtausstoß der betreffenden Firmen und dem jeweiligen Aktienanteil, den der Investor daran hält. Deshalb suchen viele französische Fonds bereits gezielt nach klimafreundlicheren Unternehmen.
Auch große staatliche Investoren wie der norwegische Staatsfonds gehen längst auf Abstand zur Kohle. Der Fonds beschloss bereits 2019, nicht mehr in die Kohleindustrie zu investieren und die entsprechenden Aktien aus dem Depot zu werfen. Hierzulande haben sich ebenfalls etliche Pensionsfonds der Bundesländer zumindest vorgenommen, künftig nachhaltiger anlegen. Zudem arbeitet die Europäische Union an einem europaweiten „Aktionsplan für nachhaltiges Investieren“, der strengere Vorgaben machen soll. Demnächst also könnte die CO2-Vermeidung zu einem wichtigen Kriterium für Anleger werden.
Nachhaltigkeit macht sich bezahlt
Dringend nötig wäre es, vor allem hierzulande, denn für die Dax-Konzerne sieht der Carbon-Fußabdruck noch so aus: Für jede Umsatzmillion, die Deutschlands 30 größte Börsenkonzerne erzielen, blasen sie 280 Tonnen CO2 in die Luft. Das ist gut das Doppelte von dem, was der Durchschnitt der 50 größten europäischen Firmen schafft. Die Eurostoxx-50-Unternehmen kommen nur auf 130 Tonnen Kohlendioxid.
Doch warum sollten Anleger nun die Luftverpester aus ihren Depots schmeißen? Es könnten schließlich hoch profitable Unternehmen sein. Sind sie nicht, sagen die Analysten von Morningstar: Langfristig gesehen fielen sich die größten CO2-Produzenten durch unterdurchschnittliche Kapitalmarktrentabilität auf und durch weniger Aktienperformance. Auch andere Studien bestätigen, dass ein messbarer Zusammenhang zwischen Aktienrendite und Umweltfreundlichkeit besteht.
Es gebe bei Unternehmen eine direkte Verbindung zwischen ihrem CO2-Ausstoß und ihrer Kapitalmarktperformance, haben Forscher der Universität Hamburg ermittelt. Dazu sahen sie sich die Daten von 4000 Unternehmen an: Einerseits den Klima-Fußabdruck, also ihre Treibhausgasemissionen – andererseits ihre Aktienkurse und Unternehmenskennziffern. Gruppiert man die Firmen je nach Schadstoffausstoß in drei Kategorien (in die Emissionsarmen, die Mittleren und die Luftverpester sozusagen) dann fielen die Wenigausstoßer durch eine deutliche Aktien-Mehrrendite im Vergleich zum Durchschnitt auf. Sie lieferten ihren Anlegern 0,39 Prozentpunkte mehr Ertrag als der Referenzindex, sagt die Studie. Die Luftverpester dagegen kamen auf eine deutliche Unterrendite. Sie schnitten 0,38 Prozentpunkte schlechter ab als der Index. Insgesamt betrug der Renditeunterschied zwischen den CO2-Guten und den CO2-Bösen knapp 0,8 Prozentpunkte. Die kann man als Anleger als Bonus einstreichen, wenn man auf die sauberen Firmen setzt und die Luftverschmutzer aus dem Depot außen vor lässt.
CO2-Fußabdruck ist ein guter Langfristindikator
Noch auffälliger war der Unterschied beim Marktwert-Buchwert-Verhältnis, also der Marktkapitalisierung (Kurs mal Aktienanzahl) im Vergleich zum Buchwert. Der Marktwert lag bei den Unternehmen mit niedrigem CO2-Ausstoß im Schnitt rund 30 Prozent höher als bei den Vielverpestern. Gerade die Börse also bewertet Firmen mit geringem Kohlendioxidausstoß durchweg positiver als es die reinen Fundamentaldaten rechtfertigen würden.
Was kann man daraus folgern? Der CO2-Fußabdruck eines Unternehmens ist offenbar ein guter Indikator dafür, wie wachstumsstark Investoren eine Firma einschätzen. Er sagt, welche Wertschöpfung man ihr auf lange Sicht zutraut. Die Unternehmensberatung Mercer hat das Renditepotenzial ebenfalls beziffert : Die „guten“ Sektoren (wie erneuerbare Energien und Infrastruktur) würden künftig Renditeaufschläge von zwei bis sechs Prozentpunkten jährlich verzeichnen. Die Kohlebranche dagegen werde sieben Prozentpunkte einbüßen, die Öl- und Gasbranche 4,5 Prozentpunkte verlieren.
Nun sind solche Bewertungen und Börsenkurse ja reine Zukunftsbetrachtungen. Und sie spiegeln lediglich die Erwartungen der Marktteilnehmer wider, die bereits heute eingepreist werden. Die spannende Frage ist, ob die umweltfreundlicheren Firmen die hohen Erwartungen der Anleger auch tatsächlich in reale Gewinne umsetzen können. Eine Vielzahl von wissenschaftlichen Arbeiten hat bereits versucht zu belegen, ob es ihnen gelingt: Laut Metastudien fanden rund 60 Prozent der Forschungsarbeiten einen positiven Zusammenhang zwischen „nachhaltiger Unternehmensführung“ und positiven Firmenergebnissen.
Bezogen auf den CO2-Ausstoß wiesen überdies 45 Prozent der Studien nach, dass weniger CO2-Ausstoß auch eine bessere „Unternehmensperformance“ bedeutete. In 39 Prozent der Studien ergab sich jedoch genau das Gegenteil, und gut 15 Prozent der Studien fanden keinen eindeutigen Zusammenhang. Das Problem all dieser Studien ist, dass sie nicht einheitlich definieren, was „Unternehmensperformance“ überhaupt ist: Mal machten die Forscher die Performance an Kapitalmarktdaten fest, mal an den Wachstumsraten der Unternehmen, mal an Profitabilität, dann wieder an der Liquidität.
Höhere Dividenden
Deshalb sahen sich die Hamburger Forscher noch einmal speziell den Punkt der Profitabilität an, nachdem sie ja schon einen Zusammenhang zwischen Finanzmarktperformance und CO2-Intensität gefunden hatten: Noch gebe es bei der Profitabilität keinen eindeutigen Zusammenhang, dass weniger CO2-Produktion zwingend mit steigenden Profiten einhergehe, stellten sie fest. Was aber daran liege, dass fossile Brennstoffe zuletzt sehr günstig gewesen seien, was natürlich positive Effekte auf die Unternehmensergebnisse gehabt habe. Wird das Erdöl wieder teurer, so wie derzeit, wendet sich auch schnell das Blatt. Zudem kosten die hohen staatlichen Umweltauflagen vor allem jene Unternehmen viel Geld, die ihre Produktion jetzt bereits auf eine umweltfreundlichere Produktion umrüsten. Und an dieser Umrüstung kommen auch die Nachzügler nicht vorbei, die sich bisher noch dieses Geld sparen.
Was sich nicht leugnen lasse: dass umweltfreundlichere Unternehmen eine bessere Finanzmarktperformance ablieferten, so betonen die Forscher. Diese Überperformance zeige sich nicht nur in Kursgewinnen, sondern auch in höheren Dividenden. Und gerade hohe Dividenden bedeuten klassischerweise, dass Firmen profitabel wirtschaften. Sonst könnten sie die Prämien an ihre Aktionäre ja nicht ausschütten. Zudem trügen die „schmutzigeren“ Unternehmen ein höheres Risiko, mahnen die Hamburger Finanzwissenschaftler: Sollte die Politik per Gesetz beschließen, dass sich Unternehmen künftig an den Umweltschäden beteiligen müssen, die sie produzierten (was immerhin denkbar ist), dann würden zum Beispiel viele deutsche Stromversorger keinen Gewinn mehr machen, sondern sogar Verluste produzierten. Auch für Automobilfirmen wäre das übrigens kritisch.
All das sollte ein Anreiz für Anleger sein, einmal das eigene Depot zu durchforsten:
- Wer jetzt konsequent sein will, der wirft die Aktien der schlimmsten Verschmutzerbranchen aus dem Portfolio. Das wäre der Desinvestment-Ansatz nach dem Ausschluss-Prinzip, also die beste Form der Dekarbonisierung im Depot. Wenn viele Anleger das machen, wäre es zumindest eine Warnung an die Firmen, denn die könnten sich dann viel schwieriger finanzieren, wenn sie weiterwirtschaften wie bisher.
- Oder Anleger behalten zumindest nur jene Aktien von Öl- oder Gas-Firmen, die zwar viel CO2 ausstoßen, aber große Einsparanstrengungen machen oder ihr Geschäft nachhaltiger ausrichten wollen als die Konkurrenz. Das wäre der Best-in-Class-Ansatz. Dann wären das unter den Ölförderern zum Beispiel Shell, Total, Eni oder Chevron. Exxon und BP dagegen geben da nicht gerade ein positives Bild ab.
Bei Fonds ist nun viel schwieriger zu erkennen, welche Produkte in ihnen stecken. Doch auch hier gibt es:
- Jene, die den Best-in-Class-Ansatz fahren (wie die Nachhaltigkeits-Varianten der großen Indizes Dow Jones oder MSCI World).
- Und jene ausgewiesenen ESG-Fonds, die oft nach dem Ausschlussprinzip funktionieren und zum Beispiel auf Aktien aus bestimmten Branchen verzichten, meist auf Waffen und Rüstung, Atomkraft, Fracking und viele auch auf Kohlebergbau. Fonds, die das deutsche FNG-Siegel tragen und zudem eine Drei-Sterne-Bewertung haben, gelten hier als besonders zuverlässig. Es sind insgesamt 37 Fonds, zum Beispiel von den Emittenten Triodos, BfS, Erste Group, Steyler Ethik Bank, Nordea und Raiffeisen Nachhaltigkeit.
- Oder aber – das ist die sicherste Variante – die Anleger fokussieren sich gezielt auf Fonds, deren „Carbon Risk Score“ klein ist, weil sie in Branchen wie erneuerbare Energien, Cleantech, Biotech oder Healthcare unterwegs sind.
Verzichten sollten umweltbewusste Anleger eher auf Rohstofffonds, Russland- und Schwellenländerfonds oder Osteuropa-Aktienpakete. Weil bei ihnen – selbst wenn sie vorgeben, sich speziell um Nachhaltigkeit zu kümmern – extrem schwer zu ermitteln ist, wie sauber die dahinterstehenden Unternehmen tatsächlich operieren. Denn nicht nur wo „Coal“ drauf steht kann hier oft Kohle oder Öl drinstecken. Für heimische Ratingagenturen ist das nur schwer zu überprüfen. Auf jeden Fall würde eine Umschichtung in saubere Firmen auf Dauer nicht nur heiße Luft produzieren. Sondern auch gute Renditen.