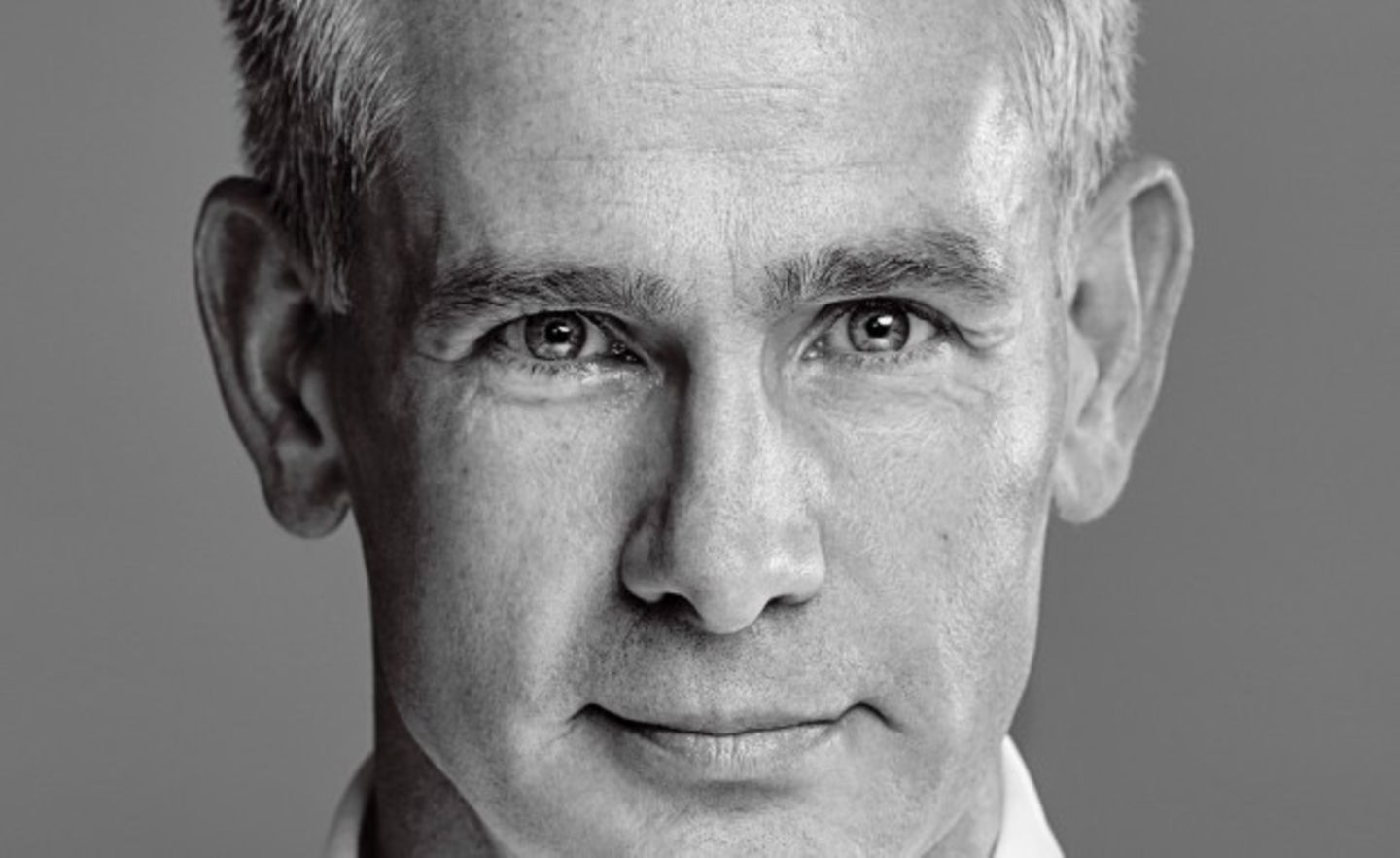Die Automobilindustrie scheint auf einer unaufhaltsamen Erfolgswelle zu reiten. Die Absatzzahlen weisen nach oben, Unternehmen weisen Umsatzrekorde aus. In Deutschland bewegt sich die Zahl der Neuzulassungen auf stabil hohem Niveau. Das Land ist automobiler Exportmeister. Laut Studien wie dem BP Energy Outlook soll sich die Zahl der Autos weltweit bis 2035 sogar verdoppeln – und dem Kraftfahrtbundesamt zufolge erhöhte sich der absolute Kraftfahrzeugbestand zwischen 2018 und 2019 erneut um rund eine Millionen. All das suggeriert: Keine Krise kann der Automobilindustrie etwas anhaben. Wie steht das im Verhältnis zu den gegenüber der Automobilindustrie regelmäßig und oft beschworenen Untergangsszenarien?
Reine Absatzzahlen sind ein gefährlicher Blick in den Rückspiegel.
- Erstens verstellen sie den Blick auf die Marktanteile im Zukunftssegment Elektrofahrzeuge.
- Zweitens fokussieren sie auf Produktion, während ein zunehmender Teil der Wertschöpfung im Mobilitätssektor durch Services generiert wird.
- Drittens sind sie kein Indikator für die Zukunftssicherheit im Bereich Digitalisierung.
Digitalunternehmen machen mobil
Die digitale Transformation verändert das Auto wie wir es kennen. Bereits heute sind viele Autos rollende Computer, ausgestattet mit digitalen Assistenz- und Infotainmentsystemen sowie einer Vielzahl an Sensoren. Klassische Erfolgsfaktoren der Branche – ausgeklügelte Motoren, Design, Fahrgefühl – sind zwar nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, doch die Digitalisierung hat das Anforderungsprofil an Fahrzeuge um eine Variable erweitert: Software (und dadurch vernetzte Hardware). Diese Entwicklung wird sich mit dem fortschreitenden technischen Fortschritt rasant fortsetzen. Stichworte Künstliche Intelligenz und autonomes Fahren.
Diesen Umstand machen sich neue Player zu nutze. Technologieunternehmen wie Alphabets Waymo oder Alibaba, das seit Mitte 2018 in Peking eine autonome Testflotte betreibt, preschen in den Mobilitätsmarkt. Ihre Stärke ist die Schwäche der Automobilkonzerne – Softwareentwicklung als Kernkompetenz. So verwischt die neue Konkurrenz die Grenzen der klassischen Automobilindustrie und zieht auf die Überholspur. Waymos autonome Autos legten schon 16 Millionen Kilometer auf öffentlichen Straßen zurück. Und Waymos erster autonomer Ridesharing-Service startete bereits in der amerikanischen Großstadt Phoenix den Regelbetrieb. Der Wandel ist längst Gegenwart.
Die junge Generation wendet sich ab
Vorweg: Das eigene Auto besitzt bei Menschen und auf dem Land weiterhin einen hohen Stellenwert. Doch Angaben des Bundesverkehrsministerium zufolge wendet sich der städtische Nachwuchs zunehmend vom Konzept des eigenen Autos ab. Diese Entwicklung wird in dem Report Mobilität in Deutschland festgehalten und drückt sich in sinkenden Führerscheinzahlen unter jungen Menschen in den Großstädten aus. Ein Indiz, dass dies kein temporäres Phänomen ist, lieferten die Autoren des Reports, welche eine „nachlassende Bindung an das Auto in den heutigen mittleren Altersgruppen” gegenüber vergleichbaren Altersgruppen aus früheren Reporten erkennen.
Was liegt dieser Entwicklung zu Grunde? Nun, es gibt immer mehr Alternativen zum eigenen Pkw. Gerade die aufstrebende Sharing-Economy wird populärer, ein Mix aus öffentlichem Nahverkehr, Ride- und Carsharing macht das eigene Auto im Alltag für viele überflüssig. Ein Beispiel: Der Statista Digital Markets Outlook zählte 2018 4,9 Millionen Nutzer von Ridesharing-Diensten und prognostiziert einen Anstieg um knapp 43 Prozent bis 2022. Langsam wird auch die Politik aufmerksam. Verkehrsminister Andreas Scheuer gab kürzlich bekannt, den Fahrdienstmarkt für digitale und plattformgetriebene Mobilitätsdienste zu öffnen – Zeit wäre es.
Spiel mir das Lied vom Diesel
Derweil sind Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit Kaufkriterien für die breite Masse geworden – nicht nur bei den Jungen. Circa 70 Prozent der Kunden legen „Wert auf Nachhaltigkeit der Produkte oder des Unternehmens” ( Sustainable Image Score 2017 ). Das heißt: selbst in den Augen designierter Autokäufer erfüllen Verbrenner diese Kriterien nicht mehr – ganz gleich, welche Euronorm im Fahrzeugpapier steht. Aktuell findet sich in der Rangliste der größten Hersteller von Elektroautos laut Clean Technica gerade einmal ein deutsches Unternehmen.
Wir erinnern uns: Deutschland wollte einst Leitmarkt und Leitanbieter der Elektromobilität werden. Das Ziel von eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen in 2020 wurde erst verschoben, dann ging praktischerweise die zuständige Nationale Plattform Elektromobilität in der neuen Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität auf. Die Ziele Leitmarkt, Leitanbieter, eine Million Elektroautos wurden vor der selbstgesetzten Frist sang- und klanglos gestrichen.
2008 wurde in Berlin Ubitricity gegründet – angetreten, einfach und flächendeckend eine Ladeinfrastruktur aufzubauen. In ihrer Gründungsstadt kamen sie trotz des Bundesprogramms „ Schaufenster Elektromobilität “ mit den Schwerpunkten Laden und Vernetzen nicht zum Zug: Stattdessen installierte London Ladepunkte in Straßenlaternen. Es brauchte erst Fahrverbote und das „Sofortprogramm Saubere Luft“, damit Berlin erkennt, dass der Wandel eine flächendeckende Ladeinfrastruktur braucht.
Streetscooter entwickelt und produziert Transporter und nimmt etablierten Herstellern Marktanteile beim Großkunden DHL ab – auch hier wurde für den Wandel gehandelt statt gewartet.
Derweil diskutieren wir im Jahr vier nach dem Dieselbetrugsskandal über Fahrverbote . Häufig heißt es: So was gibt es nur in Deutschland. Das ist falsch. Andere Länder schaffen längst Fakten. In den USA wurden die Betrugsdiesel bereits 2016 von den Straßen verbannt – bei voller Kompensation der Halter und mit Strafzahlungen für die Hersteller. Norwegen wird ab 2025 keine Verbrennungsmotoren mehr zulassen. Island, Israel, die Niederlande oder gewaltige Absatzmärkte wie China und Indien wollen diesen Schritt ab 2030 vollziehen. Frankreich und Großbritannien ab 2040. Einzelne Städte wie London verbannen bereits seit einiger Zeit ältere Verbrennungsmotoren aus der Innenstadt oder verlangen hohe Mautgebühren für die Einfahrt in bestimmte Stadtgebiete.
In Ländern mit mutigen, progressiven Entscheidern ist der Elektroantrieb weltweit etabliert, der Umgang mit dem Dieselskandal in der Nachbereitung. Die globalen Absatzmärkte wandeln sich, auch wenn wir das hierzulande teils recht langsam wahrhaben wollen. BYD in China, Tesla in den USA sind Vorreiter der Elektromobilität, Japan treibt den Wasserstoffantrieb voran. Dort haben sich Toyota, Nissan und Honda, japanische Öl- und Gasriesen sowie die Development Bank of Japan zu einem enormen Joint Venture zusammengeschlossen. Ziel: ein fortschrittlicher konkurrenzfähiger Wasserstoffantrieb.
Der Feind meines Feindes
Auch hierzulande bündeln die großen Unternehmen ihre Kompetenzen, schaffen Synergien und gehen Partnerschaften ein. So haben BMW und Daimler ihre Mobilitätsdienstleistungen wie Car2Go, Drivenow oder Mytaxi in einem Joint Venture zusammengefasst . Das ist eine gute Nachricht. Denn Lime, Bird, Uber, Lyft und andere zeigen, wie dynamisch und wachsend der Mobilitätsmarkt ist.
Viele europäische Start-ups arbeiten ebenfalls an den Mobilitätslösungen der Zukunft. Alleine im Jahr 2017 wurde gemäß Europas größtem Wagniskapitalgeber Atomico 2,6 Mrd. Euro in europäische Transport-Start-ups investiert. Auch Automobilunternehmen versuchen sich auch auf diesem Wege Kompetenz – etwa im Bereich der Softwareentwicklung – ins Unternehmen zu holen. Der Unternehmensberatung Berylls zufolge investierte etwa Daimler 2017 650 Mio. Euro in Mobilitätsstart-ups. Die Kollaboration und Zusammenarbeit mit Start-ups ist für viele Anbieter ein integraler Bestandteil für Innovationen im Unternehmen geworden.
Die aktuellen Zulassungszahlen sind verführerisch. Doch der Mobilitätswandel ist in vollem Gange. Das Innovationstempo kennt aktuell keine Höchstgeschwindigkeit. Gesucht sind Unternehmer und Entscheider mit dem Mut zum Risiko – das gilt für Start-ups wie für Platzhirsche. Nur wer keine Angst vorm Wandel hat, wird die Mobilität von morgen gestalten.
Das sind die Tesla-Konkurrenten
Das sind die Tesla-Jäger
Der französische Autobauer Peugeot zeigt in Genf eine Neuauflage seines Kleinwagenmodells 208, den es auch in einer Ausführung mit Elektromotor geben wird. 136 PS soll der Motor leisten und bis zu 340 Kilometer laufen, bevor die Batterie schlapp macht. Zum Preis machte der Hersteller noch keine Angaben.
Aus dem Hause Volvo stammt der Polestar 2, der im kommenden Jahr auf den Markt kommen soll. Er ist als direkter Konkurrent für Teslas Model 3 konzipiert. Eine Basisversion soll es für 39.000 Euro geben. Zunächst aber wird der Polestar knapp 60.000 Euro kosten.