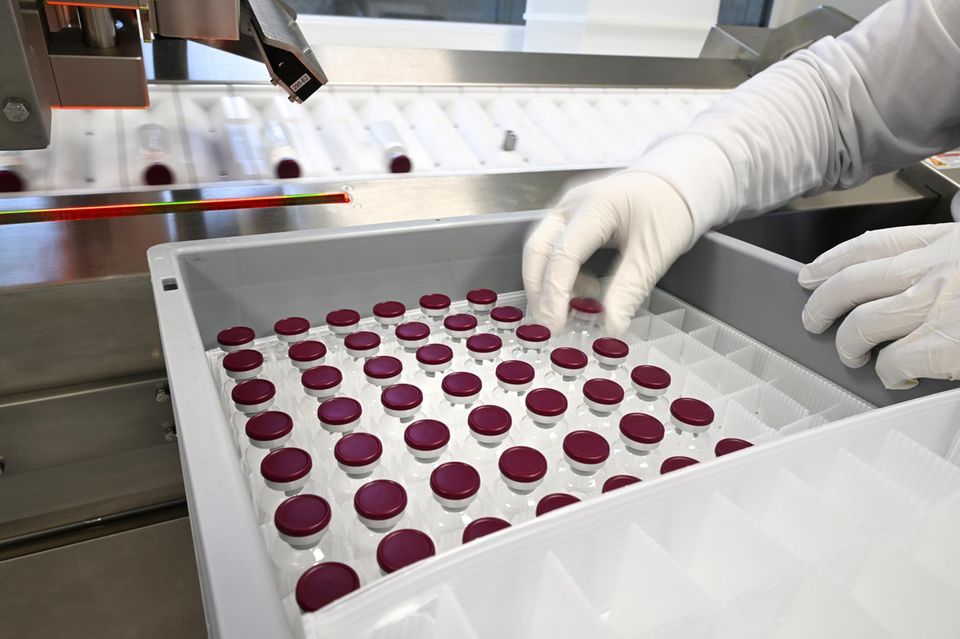Die Autoindustrie in Deutschland startet einen neuen Versuch, um beim Thema Fahrzeugsoftware Anschluss zu gewinnen. Vertreter von Herstellern wie VW, BMW, Porsche und Mercedes sowie Zulieferern, darunter, Bosch, Conti und ZF unterschrieben am Dienstag auf einem Fachkongress eine entsprechende Absichtserklärung. Demnach wollen die Beteiligten eine gemeinsame Plattform organisieren, auf der Programmierteams der beteiligten Häuser die Software zur Steuerung der Autos und der Funktionen ihrer Lieferteile gemeinsam entwickeln. Die Plattform soll nach dem Open-Source-Prinzip funktionieren, also für weitere Nutzer offen sein.
„Durch dieses Open-Source-Ökosystem in der Automobilentwicklung verkürzen wir die Zeit bis zur Marktreife, reduzieren den Aufwand für die Anwendungsentwicklungund treiben Innovationen voran,“ lobte Oliver Seifert, bei Porsche zuständig für Infotainment und Connect die Vereinbarung laut einer Mitteilung. Marcus Bollig vom Herstellerverband VDA, der den Plan mit vorangetrieben hat, sagte, dieser solle dabei helfen, dass die deutsche Autoindustrie ihre Position gegenüber Techkonzernen aus den USA und China absichern könne.
Die Hersteller und Zulieferer verbünden sich damit in einem Wettlauf, der für die gesamte Autoindustrie entscheidend wird. Denn künftig sollen alle Funktionen eines Autos von zentralen Rechnern und einem einheitlichen Software-Betriebssystem gesteuert worden – der Fachbegriff dafür ist Software Defined Vehicle (SDV). Auch wenn Autos in Zukunft autonom fahren können sollen, ist eine solche Technik nötig. In China fahren bereits viele Autos, auf die diese Kriterien zutreffen. Tesla aus den USA war in dieser Hinsicht ein Pionier, aber es gibt auch weitere US-Start-ups, die hier weit sind, wie Rivian, ein Kooperationspartner des VW-Konzerns. Die ersten SDV-Autos deutscher Hersteller sollen 2026 und 2027 auf den Markt kommen.
Gemeinschaftsprojekte waren bislang nicht erfolgreich
Bei der Software dafür versuchen, Techkonzerne wie Google, Apple oder Huawei mitzumischen und so einen Fuß in die Tür des Autogeschäfts zu bekommen. Es geht ihnen freilich nicht nur darum, als Zulieferer der Branche zu wirken. Sie beanspruchen vielmehr über die Software die Hoheit über die Daten, die die Fahrzeuge permanent liefern und die für weitere Dienstleistungen genutzt werden können. In Teilen der Autoindustrie war und ist die Furcht groß, dass die angestammten Hersteller dabei einen Großteil ihrer Wertschöpfung an die Techkonzerne verlieren könnten. Daher haben Firmen wie VW und Mercedes begonnen, Milliardenbeträge in die Entwicklung möglichst unabhängiger Software-Systeme zu investieren. Bald aber mussten sie feststellen, dass sie hier zu ehrgeizig waren, die Ergebnisse kamen zu langsam und waren fehlerhaft.
Ob der nun verkündete Pakt da der Ausweg werden kann, wird auch vom tatsächlichen Engagement der Beteiligten abhängen. Denn alle Hersteller haben ihre SDV-Projekte bereits weit entwickelt. Und Gemeinschaftsprojekte in der Vergangenheit haben oft darunter gelitten, dass am Ende die einzelnen Marken vor allem die Hoheit über ihre Produkte behalten und Entwicklungsleistungen nur ungern teilen wollten. In Japan etwa versucht die Regierung, die dortigen Hersteller mit Milliardensubventionen und politischem Druck zur Kooperation in Sachen SDV zu drängen.
Der Open-Source-Ansatz der Deutschen ist hier anders. Er soll auch von vornherein kartellrechtliche Einwände ausschließen. Die Idee sieht ausdrücklich vor, dass sich auch weitere europäische Hersteller wie etwa Stellantis oder Renault beteiligen könnten, heißt es beim VDA. Doch dem Wesen des Open-Source-Models könnten eben auch jene Firmen aus China und den USA Einblick erhalten, die man eigentlich bekämpfen will. Das wiederum könnte dazu führen, dass auch die Beteiligten am Ende nur vorsichtig bei dem Projekt mitmachen.
Hersteller setzen auf Kosteneinsparungen
Nun soll die Plattform freilich auch nach dem Willen ihrer Erfinder nicht die gesamte Softwaresteuerung umfassen, sodass am Ende, das Infotainment oder die Auslegung der Lenkung bei allen Autos gleich wäre. Es gehe vielmehr um gewisse Grundfunktionen, die die Kundschaft gar nicht merkt, heißt es beim VDA. Daran könnte dann jede Marke ihre spezifische Software anknüpfen, mit der sie sich in den Augen des Nutzerpublikums voneinander absetzen können.
Der Plan soll auch die Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Zuliefern schneller und kostengünstiger machen, wie es bei den Beteiligten heißt. Bislang müssen Lieferanten, auch wenn sie technisch gleiche Systeme wie Lenkungen oder Bremsen an verschiedene Hersteller liefern, die Software dafür aufwändig jeweils spezifisch erstellen. Wenn die neue Plattform funktioniert, könnte es hier eine weitgehend einheitliche Software geben, so die Hoffnung.
Die Softwareplattform ist nicht der erste Versuch deutscher Hersteller, enger miteinander zu kooperieren. Ein Beispiel ist der Navigationsdienst Here, an dem Audi, Mercedes, BMW, Bosch und Continental maßgeblich beteiligt sind. Ein weiteres Beispiel ist der Ladesäulenanbieter Ionity, der von VW, Mercedes, BMW, Ford und Hyundai wesentlich betrieben wird.