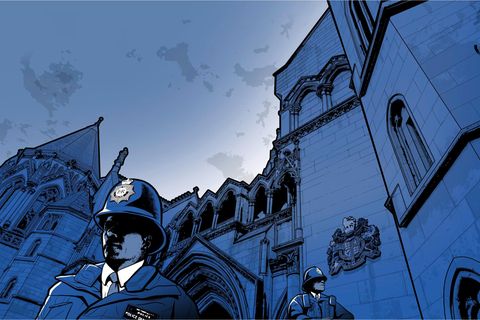Als die Europäische Union und die USA im Jahr 2014 Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängten, nachdem das Land die ukrainische Krim annektiert hatte, gab es viel Kritik. Ostdeutsche Regierungschefs wie Reiner Haseloff sprachen von einem wirkungslosen Instrument, die österreichische Außenministerin sagte, die Sanktionen hätten „schlichtweg nicht gegriffen“ und auch der amerikanische Thinktank Brookings Institution kam zu einem sehr negativen Urteil – da ein Politikwechsel über ökonomische Zwänge nicht zu erreichen sei.
Ähnlich wird nun im Falle der Türkei argumentiert, die nach einem Streit mit der US-Regierung unter Strafmaßnahmen aus Washington geraten ist. Die ohnehin labile Wirtschaft der Türkei wird an den Rand des Abgrunds gedrängt und die Lira stürzt ab, nachdem sich Präsident Recep Tayyip Erdogan mit den USA angelegt hat: Seine Behörden halten den amerikanischen Missionar Craig Brunson in einer Art Geiselhaft, um die Auslieferung von Erdogans Erzfeind Fethullah Gülen aus den USA zu erpressen. Die US-Regierung antwortete mit Strafzöllen auf Stahl und Aluminium. Natürlich hat die Wirtschaftskrise in der Türkei sehr viel tiefer gehende Ursachen. Fest steht aber, dass die US-Sanktionen diese Krise akut erheblich verschärfen.
Dabei ist die erste Frage allerdings: Was soll mit den Sanktionen überhaupt erreicht werden? Francesco Giumelli, Experte für Internationale Beziehungen an der Universität Groningen, hat dazu einen sehr brauchbaren Leitfaden entwickelt. Danach können Sanktionen drei Zielen dienen:
- einen Politikwechsel zu erzwingen,
- den anderen in seinen Optionen einzuschränken und
- das Signal zu senden, dass man die Politik des anderen ablehnt.
Wie also sind die diese Ziele zu bewerten? Was Punkt Drei angeht, so lässt sich schnell feststellen, dass dieses Ziel in der Regel erreicht wird. Die Europäische Union hat es überraschenderweise geschafft, im Fall der Russland-Sanktionen über die Jahre hinweg einig zu bleiben, auch wenn einzelne Politiker immer wieder versucht haben, die Reihen zu durchbrechen. Und auch die USA sind sich trotz der Nähe von Präsident Donald Trump zu Russlands Staatschef Wladimir Putin in dieser Frage treu geblieben. Der Kreml dürfte also verstanden haben, dass die Annexion der Krim im Westen abgelehnt wird. Ähnliches dürfte für Erdogan gelten.
Mit Punkt 1 hingegen ist es deutlich schwieriger. Putins Soldaten haben die Krim nicht verlassen und werden das mit einiger Sicherheit auch nicht tun. Und dass Erdogan den US-Geistlichen freilässt, ist zumindest kurzfristig auch nicht zu erwarten – zu offensichtlich wäre die Niederlage.
Der interessanteste Punkt ist damit Ziel 2: die sanktionierte Partei soll ausgebremst werden. Dabei muss man sich klar machen, wie Autokraten oft agieren: Sie preschen mit einem international geächteten Schritt vor, warten ab, wie die Reaktion ausfällt und wenn nichts passiert, gehen sie den nächsten Schritt. Auf diese Art und Weise lässt sich nach und nach eine neue Realität etablieren, in der akzeptiert wird, was zuvor noch verpönt war. Dem allerdings können andere Regierungen mit Sanktionen begegnen, und zwar dann, wenn sie für die betreffende Führung schmerzhaft sind.
Russland zeigt Wirkung
Im Fall Russlands lässt sich sagen: Die Strafen tun allmählich wirklich weh. Wie die Politikwissenschaftlerin Maria Snegovaja in einer Studie für das Center for European Policy Analysis nachwies, wirkt dieser Schmerz in mehreren Schritten. Zuerst wurde die russische Wirtschaft beschädigt, was sich angesichts einer Nahezu-Stagnation kaum leugnen lässt. Dies schränkt die Möglichkeiten des Kremls ein, seine Anhänger mit Wohltaten zu versorgen. Zugleich verschärft sich der Kampf in der Elite um finanzielle Zuwendungen und das Regime wird destabilisiert. Die massiven Proteste gegen die Erhöhung des Rentenalters und die sinkenden Umfragewerte für Putin zeigen, dass dieser Mechanismus tatsächlich wirkt. Snegovaja glaubt sogar, einen neuen, milderen Tonfall im Kreml zu bemerken, etwas, was sich bisher nur schwer belegen lässt.
Eines aber ist ziemlich klar: Die Sanktionen dürften Russland davon abgehalten haben, seine Aggressionen nach der Krim-Annexion fortzusetzen. Der Konflikt in der Ostukraine ist mehr oder weniger eingefroren, und auf neue militärische Ausflüge in seinem selbst ernannten Einflussbereich hat Russland vorerst verzichtet. Stattdessen verlegt sich der Kreml auf Diplomatie und damit auf ein Feld, in dem die EU mithalten kann.
Was bedeutet das nun für die Türkei und ihren machthubernden Präsidenten Erdogan? Der ökonomische Druck ist derzeit so stark (und die Lage so schlecht), dass Erdogan eigentlich nur zwei Optionen bleiben: Entweder er fährt das Land vollends gegen die Wand und besiegelt damit mittelfristig auch sein eigenes Schicksal. Oder er gibt allmählich nach, verzichtet auf weitere Machtdemonstrationen und lässt vielleicht irgendwann unter einem gesichtswahrenden Vorwand den US-Prediger aus dem Land. Eines hätten die Sanktionen damit auf jeden Fall schon einmal erreicht: Sie hätten die Optionen der türkischen Regierung eingeschränkt.
Sanktionen sind, auch das zeigt das Beispiel Türkei, ein sehr riskantes Mittel. Schwierigkeiten eines Wachstumsmarktes können sehr schnell auch zum Problem für andere Staaten werden, wie die aktuellen Turbulenzen an den Märkten zeigen. Allerdings sind sie im Umgang mit Autokraten vermutlich das einzige Mittel, das Erfolg verspricht.