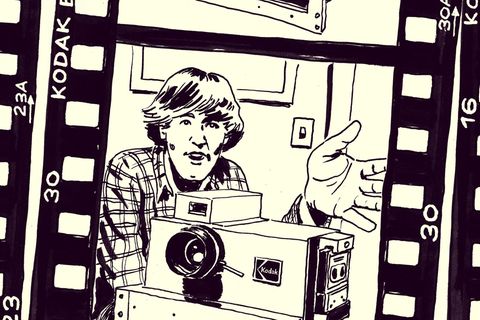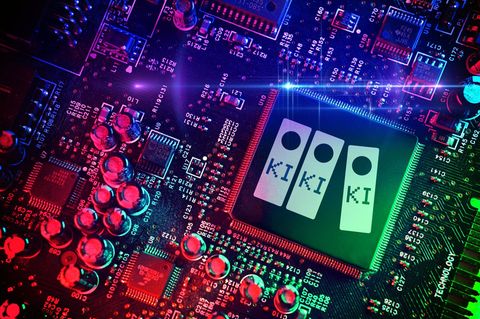Unsere Städte leiden täglich unter zähem Stop-and-Go-Verkehr, die Fahrzeiten für Pendler werden immer unkalkulierbarer, Anwohner sind genervt von Parkplatznot, Lärm und schlechter Luft. Kein Wunder, dass Verkehr und Mobilität gerade in Ballungsräumen zunehmend im Fokus der Diskussionen stehen. Kaum ein Bereich des menschlichen Alltags ist so wichtig – und gleichzeitig in großen Teilen so ineffizient – wie der motorisierte Individualverkehr im urbanen Raum: Private Pkw stehen im Schnitt 95 Prozent der Zeit und belegen wertvollen Raum. Und selbst wenn sie fahren, transportieren sie im Schnitt nur 1,2 Personen.
Die Art, wie wir uns in Städten fortbewegen, muss sich grundlegend ändern. Wir brauchen Angebote, die zu einer Reduktion des Individualverkehrs führen, darüber sind sich Verkehrsexperten, Kommunen und Bürger einig. Der Wandel ist bereits in vollem Gange, sichtbar zum Beispiel an vielen neuen Shared-Mobility-Geschäftsmodellen: Bike-, Scooter- und Car-Sharing, Shuttle-Services und Ride-Sharing-Angebote kämpfen im urbanen Raum um Marktanteile.
Auch das Taxigewerbe unternimmt wichtige Schritte, um die vorhandenen Flotten auf den Straßen wettbewerbsfähig für die Zukunft zu machen: Taxi-Bestellungen erfolgen bereits digital über Apps, die ein Höchstmaß an Transparenz und Bequemlichkeit bieten.
Mobilitätsangebote als attraktive Alternative zum eigenen Auto
Eine weitere wichtige Innovation in diesem Kontext ist das Teilen einer Fahrt mit Fahrgästen, die in gleicher Richtung unterwegs sind. In den Großstädten Hamburg, Berlin und München gibt es schon entsprechende Angebote, weitere Städte folgen bald. Taxi-Sharing lastet bereits vorhandene Taxiflotten besser aus und spricht gleichzeitig neue, preissensitive Zielgruppen an.
Damit urbane Mobilität reibungslos und flächendeckend funktioniert, ist es wichtig, eine Mischung aus Angeboten zu entwickeln, die Mensch und Umwelt nicht weiter belasten. In vielen Ballungsräumen ist inzwischen ein attraktiver Mix aus Bike-Sharing, Car-Sharing, Taxi (-Sharing), Mietwagen, Bus & Bahn etc. entstanden. Wenn der Mix dieser Verkehrsarten zukünftig von multimodalen Mobilitätsplattformen für den Fahrgast effizient organisiert werden kann und deren Nutzung etwa durch gemeinsames Ticketing möglich ist, dann wird er zu einer attraktiven Alternative zum eigenen Auto in der Innenstadt.
Taxis ergänzen den klassischen ÖPNV
Dabei spielen die traditionellen Säulen der städtischen Mobilität – der ÖPNV und das Taxi – auch zukünftig eine zentrale Rolle. Gerade Taxis können den Verkehr deutlich effizienter gestalten, denn sie ergänzen den klassischen ÖPNV und füllen dessen räumliche und zeitliche Lücken. Mit ihrer Betriebs-, Beförderungs- und Tarifpflicht gewährleistet das Taxigewerbe die Verfügbarkeit eines Transportmittels zu jeder Tages- und Nachtzeit, an jedem Ort und zu kalkulierbaren, transparenten Preisen. Umso entscheidender ist es, dass sich das Taxigewerbe richtig positioniert und weiterhin eine verlässliche Säule städtischer Mobilität bleibt.
Mit der App-Technologie hat sich im Ridesharing-Segment auch die Verkehrsart “Mietwagen” (mit Chauffeur) weiterentwickelt. Mietwagen wurden in den 1960er Jahren als Chauffeur-Service im Personenbeförderungsgesetz (PBefG) definiert. Diesen Service gab es stets nur auf Vorbestellung für Kunden mit gehobenen Ansprüchen, während das Taxi die Beförderung für das breite Kundensegment entgegennahm. Einen direkten Wettbewerb zwischen Taxi und Mietwagen sah das Gesetz folglich gar nicht vor. Aufgrund der Möglichkeit, Fahrten per App zu vermitteln, mischt inzwischen auch das Mietwagengewerbe kräftig im Wettbewerb um Fahrgäste mit.
Wegen der unterschiedlich zugedachten Rollenzuteilung unterliegt diese Verkehrsart aber völlig anderen Rahmenbedingungen als Taxis: Für Mietwagen gibt es zum Beispiel keine Vorschriften in Bezug auf die Fahrpreise. Zudem müssen Mietwagenfahrer anders als ihre Taxikollegen keine aufwändige Ortskenntnisprüfung absolvieren. In Abgrenzung zum Taxi muss der Mietwagen - weil ja nur auf Vorbestellung verfügbar - nach jeder Auftragsfahrt zum Betriebssitz zurückkehren. Spätestens hier entsteht das größte Problem: Bei einer App-Vermittlung von Mietwagen lässt sich kaum überprüfen, ob eine korrekt abgewickelte Anschlussfahrt vorliegt oder ob sich das Fahrzeug unerlaubt und jenseits des Betriebssitzes bereithält und somit dem stark regulierten Taxigewerbe unerlaubte Konkurrenz macht.
Dabei ist nicht die Konkurrenz an sich der Punkt, sondern die ungleichen Wettbewerbsbedingungen. Denn duldet man diese Praxis oder schafft gar die Rückkehrpflicht zur Betriebsstätte ab, wird das verheerende Folgen für das Taxigewerbe haben. Vielfältig sind derzeit die politischen Überlegungen, wie man die gesetzlichen Vorschriften in das digitale Zeitalter übertragen kann. Die Große Koalition hat sich vorgenommen, faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Das ist zwingend notwendig, damit die Branche auch weiterhin existenzfähig bleibt.
Gesetzlicher Rahmen muss sich dem digitalen Wandel anpassen
Das Personenbeförderungsgesetz und verwandte Verordnungen müssen an die aktuellen technischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten angepasst werden. Das Taxi- und Mietwagengewerbe inklusive neuer Ridesharing-Angebote sollte fairen Wettbewerbsbedingungen unterliegen. Jede Art der (De-)Regulierung ist dahingehend zu überprüfen, ob sie zu einer Reduktion der motorisierten Individualmobilität führt und zur Versorgungssicherheit der Bevölkerung einen Beitrag leistet.
Diskutiert werden in diesem Rahmen eine Lockerung der Ortskundeprüfung, die Abschaffung der Limitierung von Taxikonzessionen und die Flexibilisierung der Tarife innerhalb eines gewissen Rahmens. Gleichzeitig müssen taxiähnliche Mietwagenflotten ohne Shared-Mobility-Ansatz hinterfragt werden, denn sie erhöhen das Verkehrsaufkommen in unseren Städten, ohne den gewünschten Mehrwert zu bieten.
Mobilität sollte erschwinglich bleiben
Die Kommunen tun gut daran, sich für den Erhalt eines starken Taxigewerbes auszusprechen. Betriebs- und Beförderungspflicht stellen sicher, dass jederzeit auch im äußersten Stadtrandgebiet ein Transportmittel verfügbar ist. Ein stabiles Preisgefüge durch Preisober- und Untergrenzen sorgt dafür, dass Mobilität erschwinglich bleibt und die Auskömmlichkeit des Fahrpersonals sichert.
Auch für den ländlichen Raum schaffen Ride-Sharing-Angebote Lösungen. Ein leerer Linienbus, der einmal stündlich durch den Landkreis tingelt, ist weder effizient noch attraktiv gegenüber dem Individualverkehr; ein Großraumtaxi, das app-gestützt ohne feste Routen Menschen mit ähnlicher Fahrtrichtung einsammelt, hingegen schon.
In den nächsten 15 Jahren wird die Bevölkerung in den Ballungsräumen um 10 bis 15 Prozent wachsen. Die Nachfrage nach Mobilität wird folglich signifikant steigen. Handeln wir nicht, wird sich die Situation bei Verkehr und Luftqualität weiter verschärfen. Wir tun also gut daran, rechtzeitig die Weichen zu stellen und neue, sinnvolle Angebote neben dem Bewährten zuzulassen und in multimodale Vermittlungsplattformen zu integrieren.