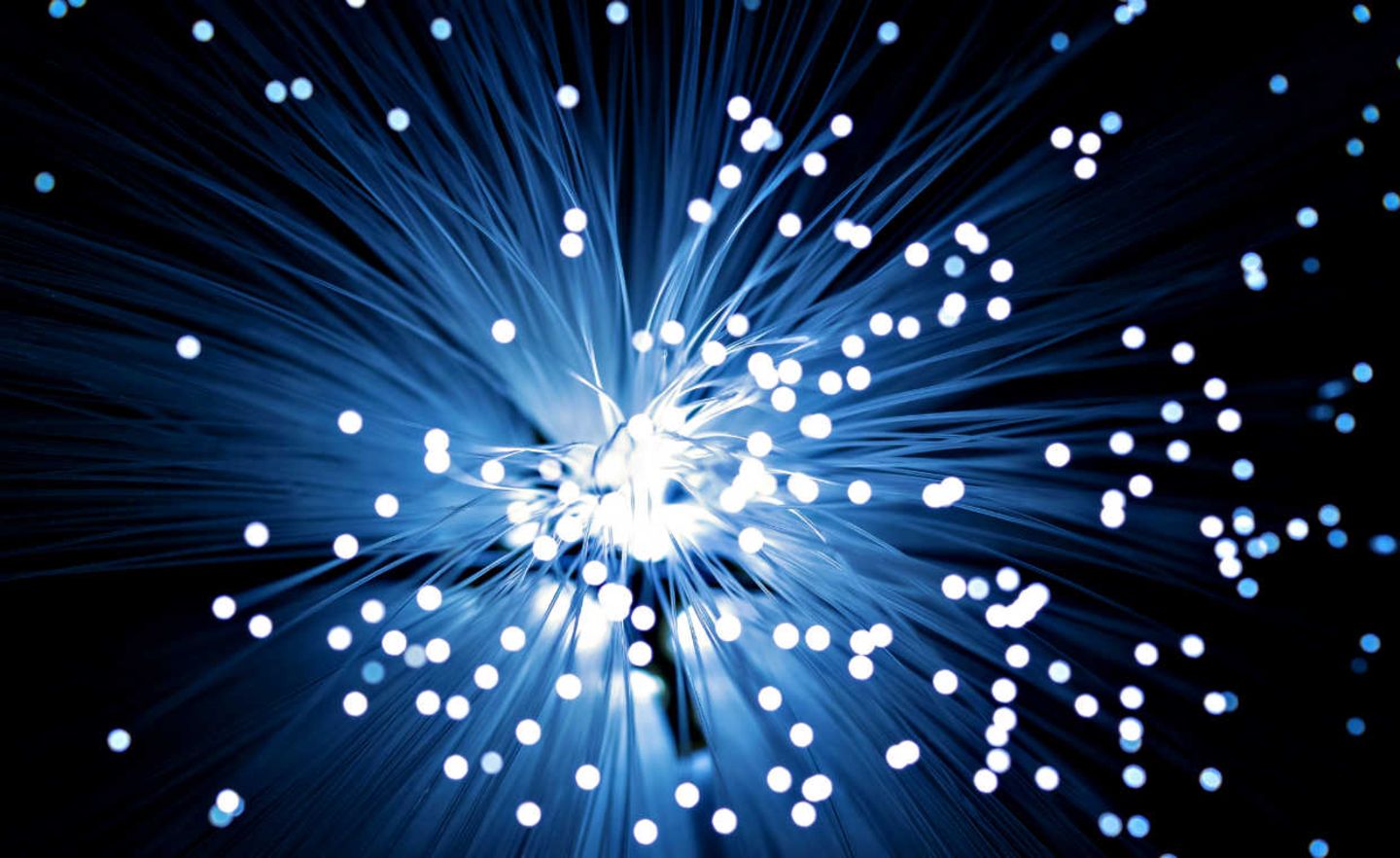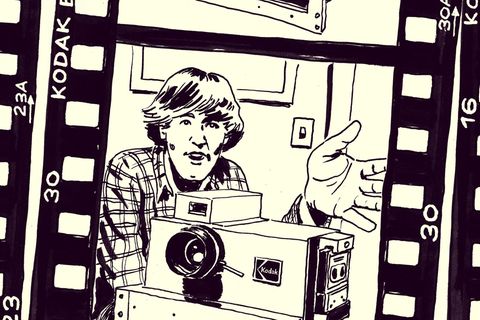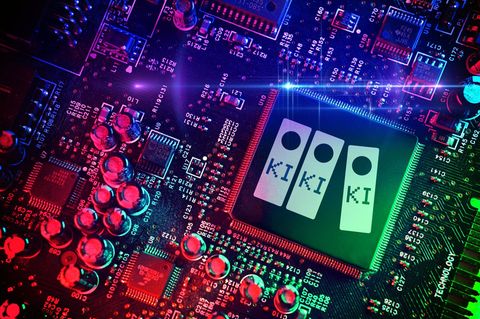Wenn Sie derzeit auf einer Party Eindruck machen wollen, müssen Sie nur einen Satz mit „künstlicher Intelligenz“ sagen. Natürlich sprechen Sie von „KI“ (oder noch besser von der englischen Abkürzung: AI). Sie sagen: „Ich stecke mitten in einem KI-Projekt.“ Oder: „Wir investieren jetzt massiv in KI.“
Künstliche Intelligenz ist das, was vor fünf Jahren die Digitalisierung war: the hottest stuff in town. Und deshalb schwirrt dieser Trend (der im Grunde nur die nächste Stufe der Digitalisierung ist) um uns herum wie ein Bienenschwarm, und das Summen ist voller Ängste, Hoffnungen, Sorgen und Segnungen.
Wir hören von Elon Musk, der vor einem dritten Weltkrieg durch KI warnt, vom Physiker Stephen Hawking, der gar das Ende der Menschheit beschwört. Es ist die alte Angst, die wir aus Filmen wie „2001: Odyssee im Weltraum“ kennen, in dem der Computer HAL 9000 die Kontrolle übernimmt, oder aus „Terminator“, in dem Maschinen den Menschen auslöschen.
Andere, wie Facebook-Chef Marc Zuckerberg , schwärmen vom nächsten Zeitalter und gigantischen Wohlstandsgewinnen. Und Andrew Ng, einer der wichtigsten KI-Köpfe unserer Zeit sagt, sich vor Künstlicher Intelligenz zu fürchten sei wie sich um die Überbevölkerung des Mars Sorgen zu machen.
Trainieren statt programmieren
Klar ist: Die Präsenz von KI in unserem Leben nimmt zu, in rasender Geschwindigkeit. Wir lesen von Google-Software, die im Brettspiel Go gegen den Weltmeister gewinnt, von Algorithmen, die Gedichte, Romane und Drehbücher schreiben sowie E-Mails beantworten, die Architektur erkennen und Hunderassen, die Bewerbungen in Unternehmen filtern – oder sogar in den Vorstand einziehen, wie bei einem Finanzinvestor aus Hongkong .
Was genau aber passiert eigentlich? Und was ist der Auslöser?
Im Kern geht es darum, dass wir Software immer öfter nicht programmieren, sondern trainieren – und diese dann Muster erkennt, selbst lernt und immer besser wird. Und das in rasender Geschwindigkeit, in dem Gehirn nachempfundenen Strukturen, sogenannten neuronalen Netzen. Diese führen im Gegensatz zu herkömmlicher Software nicht mehr nur einfach Befehle aus – ihre Knotenpunkte arbeiten nach dem Trial-and-Error-Prinzip, und können daher sich erinnern und verbessern. Der Mensch weiß nicht mehr genau, was in diesen Netzen passiert, daher auch die Terminator-Angst vor dem Kontrollverlust.
Prozesse, Produkte, Propaganda
Der Traum von Künstlicher Intelligenz ist jahrzehntealt, erste Gehversuche und Projekte gab es schon in den 1950er-Jahren, aber der Durchbruch oder Boost kam erst vor einigen Jahren, denn erst seitdem haben wir die technische Infrastruktur – durch schnelle Prozessoren und Bandbreite – und vor allem genügend Daten, um sie wirklich zu nutzen.
Wir erleben KI, so habe ich gelernt, in drei Formen, den „drei P“: Prozesse, Produkte, Propaganda. Letztere sind die Showcases, Demonstrationen des Könnens, die für Schlagzeilen sorgen: Ein Computer spielt Go oder Schach gegen Menschen und gewinnt. Auch Software, die Drehbücher schreibt, soll eher zeigen: Schaut mal, was möglich ist. Das Brettspiel Go zu beherrschen ist ja kein Ziel von Google. Es geht um die Technologie, die dann in anderen Bereichen – etwa der Pharmaforschung – eingesetzt werden kann.
Mit KI schaffen wir vor allem neue Produkte, die Einzug in unseren Alltag halten: persönliche Assistenten in Smartphones wie Siri oder in Lautsprechern wie Amazons Alexa; auch Übersetzungsprogramme zählen dazu und irgendwann einmal selbstfahrenden Autos.
Am kompliziertesten wird es mit den Prozessen, weil diese fast jedes Unternehmen betreffen und den meisten nicht klar ist, wie – und was sie tun sollen. Künstliche Intelligenz ist keine Abteilung, die man an seine Firma andockt, nach dem Motto: Wir stellen jetzt noch zwei KI-Experten ein, die sitzen dann im Erdgeschoss hinten links.
Künstliche Intelligenz verändert die Organisation, verändert Geschäftsmodelle, Berufe, schafft neue Märkte . Sie bringt der Wirtschaft und der gesamten Gesellschaft das Mega-Update, mit allen Risiken und Ungleichgewichten, dass es Gewinner und Verlierer geben wird. Und weil vieles so unklar ist, fasziniert und sorgt uns diese Technologie gleichermaßen. Höchste Zeit also, dass wir uns regelmäßiger und intensiver damit beschäftigen.