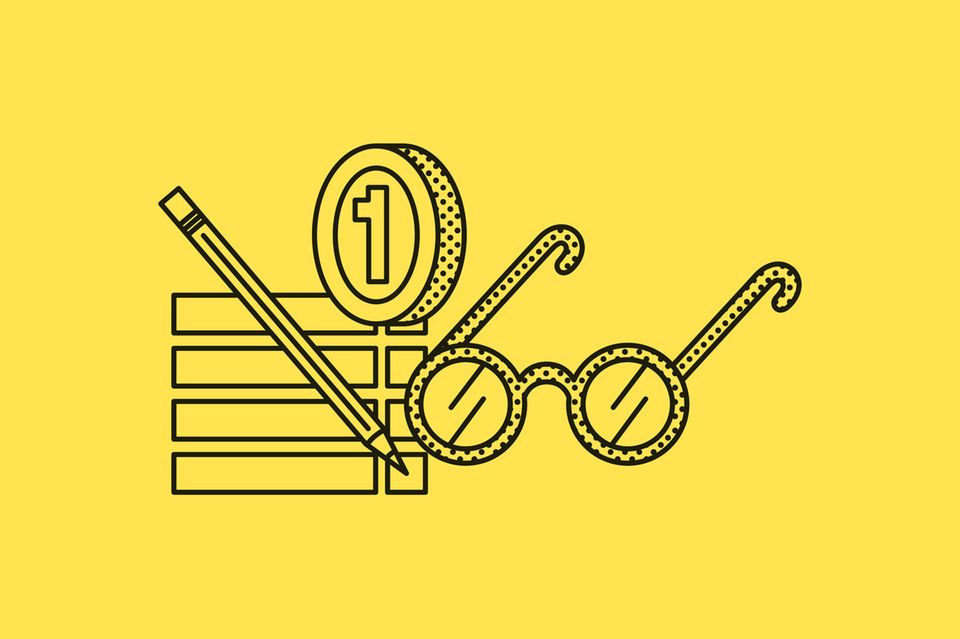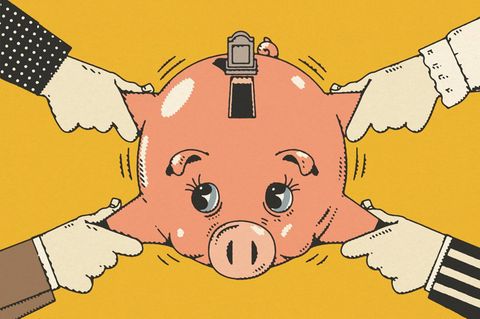Finanzminister Christian Lindner hat einen Plan für eine Art Steuerreform vorgelegt und damit ein wildes Echo an Reaktionen hervorgerufen. Während die einen von einer überfälligen Entlastung breiter Bevölkerungsschichten sprechen, kritisieren die anderen, dass Topverdiener zu stark profitieren. Der Finanzminister selbst ergeht sich derweil in verbalen Verwirrspielen. „Hier geht es nicht um eine Entlastung, sondern einen Verzicht auf Belastung“, erklärte Lindner am Mittwoch bei der Vorstellung seiner Pläne. Sein eigener Gastbeitrag in der FAZ, in dem er die Pläne erklärt und begründet, ist hingegen überschrieben mit den Worten: „Eine Entlastung für 48 Millionen Bürgerinnen und Bürger“.
Wie auch immer. Es geht jedenfalls um viel Geld – nämlich um zehn Mrd. Euro. Die wichtigsten Fragen und Antworten.
Warum überhaupt eine Steuerreform?
Die aktuell hohen Inflationsraten machen das Leben der Bürger teurer. Selbst wer in der Lage ist, eine Gehaltserhöhung in Höhe der Inflation auszuhandeln, verliert Kaufkraft. Denn ein höheres Bruttogehalt sorgt dafür, dass man in einen höheren Steuertarif rutscht, sodass man am Ende nicht entsprechend mehr netto in der Tasche hat. Diesen Effekt der sogenannten "kalten Progression" will Lindner mit seinem Inflationsausgleichsgesetz bekämpfen.
Was ist genau geplant?
Genau genommen sind Lindners Pläne keine strukturelle Reform, sondern eine Anpassung von Grenzwerten. So soll der jährliche Grundfreibetrag, bis zu dem gar keine Einkommensteuer gezahlt wird, im kommenden Jahr von 10.347 Euro auf 10.632 Euro steigen und 2024 auf 10.932 Euro. Entsprechend steigen auch die weiteren Grenzwerte, ab denen man in einen höheren Steuertarif rutscht, nach oben. Der Spitzensteuersatz von 42 Prozent schließlich soll nicht mehr ab 58.597 Euro, sondern erst ab 61.972 Euro (2023) und 63.515 Euro (2024) greifen. Der sogenannte Reichensteuersatz von 45 Prozent für die Sehr-Gut-Verdiener greift unverändert ab 277.826 Euro.
Angehoben wird auch das Kindergeld beziehungsweise der Kinderfreibetrag. Das passierte aber auch – ebenso wie beim Grundfreibetrag – in den vergangenen Jahren regelmäßig, weil dies gesetzlich vorgeschrieben ist.
Wer wird nun wie stark entlastet?
Das hängt davon ab, wie viel man verdient. Generell gilt: In absoluten Zahlen werden Besserverdiener stärker entlastet als Geringverdiener Relativ zum Einkommen ist die Entlastung meist bei Geringverdienern höher. Wer gar keine Einkommensteuer zahlt, weil er zu wenig (weniger als der Grundfreibetrag) oder nichts verdient, hat auch von der Entlastung nichts.
Laut Finanzministerium beträgt die Entlastung im kommenden Jahr für einen Single bei einem zu versteuernden Einkommen von 30.000 Euro 172 Euro. Bei 50.000 Euro sind es 352 Euro und bei 70.000 Euro 479 Euro. 2024 läge die Entlastung für diese drei Beispiele bei 278 Euro, 535 Euro und 730 Euro gegenüber dem aktuell geltenden Tarif.
Ein Ehepaar mit zusammen 50.000 Euro zu versteuerndem Einkommen würde nach dem Splittingtarif um 282 Euro entlastet (2024: 470 Euro), bei 70.000 Euro um 416 Euro (2024: 660 Euro) bei 130.000 Euro Einkommen um 958 Euro (2024: 1460 Euro).
Ist das sozial gerecht?
Da gehen die Meinungen auseinander. Finanzminister Lindner betont, dass Menschen mit hohen Einkommen vom Ausgleich der kalten Progression relativ gesehen weniger profitieren als Menschen mit geringeren Einkommen, obwohl ihre Entlastung in Euro und Cent höher ist. Unterm Strich sei das nur fair. Unterstützung erhält er von Wirtschaftsvertretern wie dem Industrieverband BDI und dem Arbeitgeberverband BDA sowie aus der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.
In der SPD und bei den Grünen gibt es dagegen teils deutlichen Widerstand gegen die Entlastungen für Besserverdiener. „Milliarden-Steuererleichterungen, von denen viel Verdienende absolut gesehen dreimal so stark profitieren wie weniger Verdienende - das ist nicht auf der Höhe der Zeit“, sagte etwa die Grünen-Finanzexpertin Katharina Beck den RND-Zeitungen. Auch Sozialverbände übten Kritik und fordern statt eines Ausgleichs der kalten Progression für alle lieber gezielte Zuschüsse für Ärmere.
Diese Position unterstützt auch der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher. Lindners Konzept bevorzuge Gutverdienende, da diese einen Großteil der Inflationsgewinne des Staates erhalten, obwohl die Inflation Geringverdiener viel stärker treffe, erklärte Fratzscher der Rheinischen Post. Lindners Plan setze daher „die falschen Prioritäten“ und werde die Ungleichheit und die soziale Polarisierung weiter verschärfen“.
Und was sagt der Bundeskanzler? Olaf Scholz hat sich in einer ersten Reaktion diplomatisch geäußert. Er sehe die Pläne mit „grundsätzlichem Wohlwollen“, erklärte ein Sprecher des Kanzlers. Sie könnten „Teil eines Gesamtentlastungskonzepts mit Blick auf den Herbst“ sein.
Die Diskussionen, wer welche Entlastungen bekommen soll, hat grade erst begonnen.
Dieser Beitrag ist zuerst auf stern.de erschienen.