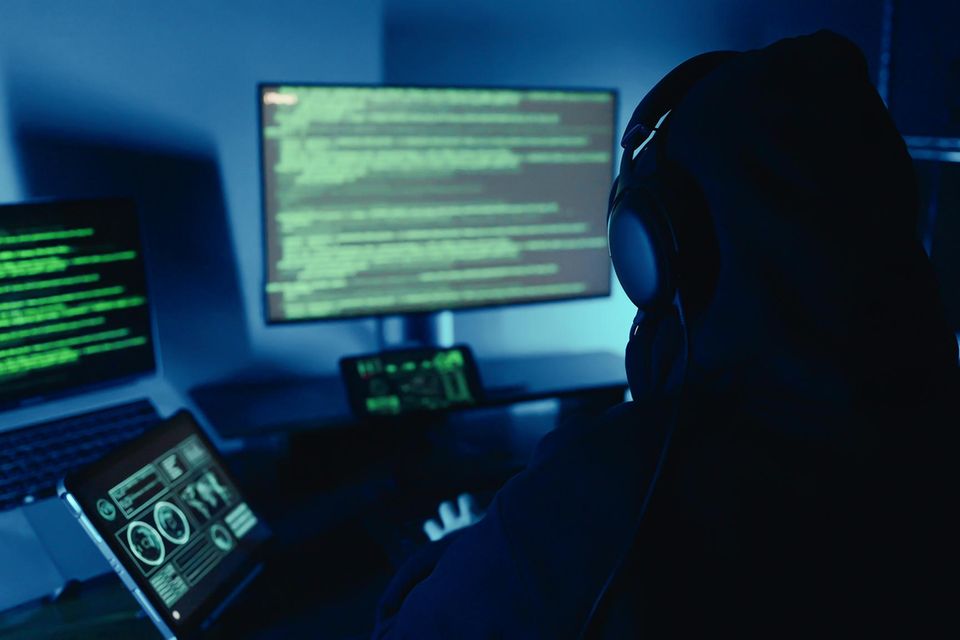Der 31. Dezember 2023 war im schier unendlichen Theater um die Masken-Aufträge der Bundesregierung aus dem Corona-Frühjahr 2020 ein wichtiges Datum. Mit Ablauf des Jahres 2023 trat für die meisten Masken-Lieferanten, denen der Bund wegen angeblicher Mängel oder verspäteter Lieferungen bis heute kein Geld überwiesen hat, die Verjährungsfrist für mögliche Klagen gegen das Bundesgesundheitsministerium ein. Entsprechend erreichten das zuständige Landgericht Bonn auf den letzten Metern noch einmal zahlreiche Klagen: Allein im Dezember waren es 26 neue Maskenklagen, wie eine Sprecherin des Gerichts auf Capital-Anfrage mitteilte. Streitwert: rund 450 Mio. Euro.
Damit springen die finanziellen Risiken für den Bund, die aus den Masken-Geschäften des ehemaligen Gesundheitsministers Jens Spahn (CDU) resultieren, noch einmal kräftig nach oben. Zum letzten bekannten Stand Ende September 2023 hatte sich der Streitwert der Masken-Klagen nach Angaben des Ministeriums auf rund 988 Mio. Euro summiert. Selbst wenn man berücksichtigt, dass einzelne der damals anhängigen Verfahren zwischenzeitlich beendet worden sein könnten – etwa durch einen Vergleich – ist klar: Das Klagerisiko für die Bundesregierung liegt jetzt deutlich oberhalb der Marke von 1 Mrd. Euro.
Den Steuerzahlern droht damit aus dem Maskenchaos sogar ein noch weitaus höherer Schaden als im Skandal um die gescheiterte Pkw-Maut des damaligen Verkehrsministers Andreas Scheuer (CSU). Exakte Angaben zum Gesamtvolumen der noch anhängigen Klagen konnte das Landgericht nicht machen, ebenso wenig zu den bisher abgeschlossenen Vergleichen.
Bei den Klagen geht es um das sogenannte Open-House-Verfahren, das Spahn wegen des eklatanten Mangels an Schutzmasken zu Beginn der Corona-Pandemie gestartet hatte. Bei diesem vereinfachten Beschaffungsverfahren garantierte der Bund sämtlichen Lieferanten die unbegrenzte Abnahme von Masken zu einem fixen Termin. Wegen der zugesagten 4,50 Euro netto pro FFP2-Maske – ein Preis, der selbst in der Ausnahmesituation im Frühjahr 2020 sehr hoch war – wurde das Gesundheitsministerium von Lieferanten überrannt. Später trat es von zahlreichen der zunächst 733 Zuschläge mit einem Gesamtvolumen von 6,4 Mrd. Euro zurück und verweigerte die Bezahlung. In vielen Fällen machte es dafür Qualitätsmängel bei der Ware geltend, in anderen monierte es eine verspätete Anlieferung.
Teuerste Klage über 450 Mio. Euro
Während manche der bezuschlagten Händler tatsächlich nicht liefern konnten oder sich aus anderen Gründen als unseriös erwiesen, wehrten sich andere gegen das Vorgehen des Bundes, weil sie dessen Gründe für verweigerte Zahlungen für vorgeschoben halten. Seit dem Frühjahr 2020 bis Ende 2023 gingen beim Bonner Landgericht insgesamt 175 Klagen von Lieferanten ein. Davon geht es allein in einem Verfahren um einen Streitwert von 450 Mio. Euro. In einer mittleren zweistelligen Zahl an Fällen ging wiederum der Bund gegen Händler vor, um sich sein Geld zurückzuholen.
Mehr als dreieinhalb Jahre und unzählige Verhandlungstermine sind seit den ersten Klagen vergangen, lange dümpelten die Verfahren vor sich hin, auch weil der Bund auf Zeit spielt und diverse Gutachter eingeschaltet wurden. Zuletzt tat sich jedoch etwas: In einigen wichtigen Teilfragen entschied die zuständige Erste Zivilkammer des Landgerichts gegen das heute von Spahns Nachfolger Karl Lauterbach (SPD) geführte Gesundheitsministerium. So sprach sie etwa im Sommer 2023 in zwei Fällen den Lieferanten ein Anrecht auf eine Kaufpreiszahlung seitens des Ministeriums zu – nebst saftigen Verzugszinsen von neun Prozent über dem Basiszinssatz.
Vergangenen November gab das Gericht zudem in einer Verfügung eine Kehrtwende in einer zentralen Frage bekannt: Demnach will die Kammer nun die Linie vertreten, dass das Gesundheitsministerium in jenen Fällen, in denen es Mängel an den Masken rügte, den Händlern die Möglichkeit hätte zubilligen müssen, innerhalb einer bestimmten Nachfrist neue Ware zu liefern. Eine entsprechende Verfügung der Kammer liegt Capital vor.
Sollte sich diese Linie in den Urteilen der noch offenen Verfahren niederschlagen, hätte dies erhebliche Folgen für den Bund: Dann nämlich könnten die Lieferanten in diesen Fällen womöglich noch neue Masken nachliefern – und zwar zum damaligen Kaufpreis. In diesem Fall müsste der Bund noch Millionen Masken abnehmen, obwohl in seinen Lagern seit Spahns Einkaufsoffensive 2020 bereits Massen an Masken liegen: Aktuell sind es rund 312 Millionen FFP2-Masken und rund eine Milliarde OP-Masken, wie das Gesundheitsministerium jüngst in seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage der damaligen Linke-Fraktion im Bundestag mitteilte. Seit Monaten werden bereits unzählige Masken aus der Anfangszeit der Pandemie entsorgt, weil das Haltbarkeitsdatum abgelaufen war.
Staatsgeheimnis um Vergleiche
Womöglich auch wegen der jüngsten Schlappen und Signale des Gerichts bemühen sich das Gesundheitsministerium und seine Anwälte verstärkt um Vergleiche mit Open-House-Klägern. In der Antwort auf die Kleine Anfrage gab das Lauterbach-Ressort die Zahl der bis heute abgeschlossenen Vergleiche mit „rund 80“ an – also für fast die Hälfte der seit 2020 eingereichten Masken-Klagen. Allerdings verweigerte es weitere Angaben zu den Vergleichen, selbst in allgemeiner Form – etwa auf welches finanzielle Gesamtvolumen für den Bund sich die Vergleiche summieren und um wie viele Masken es dabei insgesamt geht.
Auch eine Beschwerde der Linken bügelte Lauterbachs Staatssekretär Edgar Franke (SPD) pauschal ab und beharrte auf Geheimhaltung: Es seien „neben Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen auch fiskalische Interessen und Verhandlungspositionen des Bundes im Rahmen von zukünftigen Vergleichsschlüssen betroffen“, heißt es in der Antwort von Franke an den Bundestagsabgeordneten Christian Görke (Linke), das Capital vorliegt. Auch die Lieferanten verpflichten sich in den Vergleichen zu strikter Vertraulichkeit.
Nun ist es selbst mit sehr viel Fantasie schwer vorstellbar, inwiefern die Nennung einer Gesamtsumme für die rund 80 Vergleiche in den Bonner Open-House-Verfahren konkrete Rückschlüsse auf einzelne, noch nicht einmal namentlich bekannte Lieferanten zulassen soll – und wie damit ihre Geschäftsgeheimnisse auch nur ansatzweise berührt sein könnten. Ebenso grotesk wirkt das Argument des Ministeriums, allein durch das Bekanntwerden einer Gesamtsumme könnten die fiskalischen Interessen des Bundes berührt sein – vorausgesetzt, die Ausgaben für die Vergleiche werden sauber aus dem Haushalt und dem für die Bekämpfung der Corona-Pandemie vorgesehenen Etatposten des Ministeriums finanziert, wie es versichert. Solange Lauterbach aber sogar unter Verschluss halten lässt, wie viel sein Ressort in Summe für Masken-Vergleiche ausgegeben hat, lässt sich dies nicht überprüfen.
Auf Anfrage von Capital wollte sich sein Ministerium gar nicht erst an einer näheren Erklärung für die Gründe versuchen, die es für seine Geheimniskrämerei anführt. „Das BMG hat zum Sachverhalt keine Ergänzungen und hält weiterhin an den genannten Erläuterungen fest“, teilte ein Sprecher lediglich mit. Fraglich ist aber, ob sich die Haushälter im Bundestag auf Dauer mit dünnen Erklärungen und verweigerten Angaben zu den Kosten der Masken-Vergleiche begnügen werden – insbesondere seit der Bund nach dem Urteil des Verfassungsgerichts zum Klimafonds (KTF) viel stärker auf seine Ausgaben achten muss.
Bei seinem Amtsantritt Ende 2021 hatte Lauterbach eigentlich zugesagt, Transparenz in die Maskendeals aus der Frühphase der Pandemie zu bringen. Doch in der Praxis fährt sein Ministerium eine völlig andere Linie. „Die Ampel ist die Koalition der leeren Versprechen. Lauterbach wollte mit dem Maskenchaos seines Vorgängers Jens Spahn aufräumen, mittlerweile scheint er das vergessen zu haben. Womöglich hat er sich bei der Vergesslichkeit des Bundeskanzlers angesteckt“, sagte der Abgeordnete Görke, der bis zur Auflösung der Linke-Fraktion im Dezember deren finanzpolitischer Sprecher war. Die „Informationsblockade“ von Lauterbachs Ressort zu den Vergleichen könne er sich nur damit erklären, dass die Gerichts- und Vergleichskosten der Ampel peinlich sein müssten, sagte Görke. „Dabei sind das Gelder, die die Öffentlichkeit sehr wohl angehen.“
Fast eine halbe Milliarde Euro für Nebenkosten
Währenddessen steigen auch fast vier Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie die Nebenkosten für den damaligen Masken-Großeinkauf immer weiter. Diese sogenannten Annexkosten umfassen etwa den Transport, die Lagerung und die spätere Vernichtung von Masken – sowie die Ausgaben für Anwaltskanzleien, die den Bund in den Masken-Verfahren vor Gericht vertreten. Wie das Gesundheitsministerium auf die Anfrage der damaligen Linke-Fraktion mitteilte, summierten sich die Annexkosten bis Ende 2023 auf 451 Mio. Euro.
Mehr als 100 Mio. Euro davon flossen noch unter Spahn ohne Ausschreibung an die Münsterländer Logistikfirma Fiege, wie Capital im Herbst 2020 offenlegte. Ein weiterer Großauftragnehmer ist EY. Das Prüf- und Beratungsunternehmen sollte ab April 2020 das Chaos beim Masken-Einkauf ordnen. Zugleich wurde die Rechtsberatungstochter EY Law federführend mit der Abwehr der Klagen beauftragt und kassierte dafür bis heute weit mehr als 40 Mio. Euro an Honoraren. Insgesamt belaufen sich die Zahlungen des Gesundheitsministeriums an EY sogar auf mehr als 80 Mio. Euro. Und mit jedem Schriftsatz, den die EY-Anwälte im Zusammenhang mit den Masken-Klagen vor Gericht einreichen, erhöht sich diese Summe weiter.