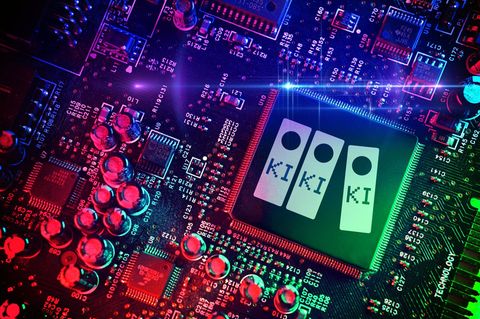Viele leitende Angestellte stehen den aufkommenden Assistenzprogrammen auf Grundlage von Künstlicher Intelligenz (KI) eher skeptisch gegenüber. Laut einer neuen Studie wollen selbst KI-erfahrene Manager die sogenannten KI-Agenten höchstens für Routine- und Assistenzaufgaben einsetzen. Das hat eine Befragung von 1000 Unternehmensentscheidern in Deutschland durch das Umfrageinstitut Civey ergeben. Die von Microsoft beauftragte Untersuchung lag Capital exklusiv vor.
61 Prozent der Befragten trauen laut der Umfrage KI-Agenten Routineaufgaben zu. Für Assistenztätigkeiten würden 45 Prozent die neuen Apps einsetzen, die selbständig Entscheidungen treffen und Aufgaben erledigen sollen. Bei anspruchs- und verantwortungsvolleren Tätigkeiten zögern die Manager hingegen: Nur 15 Prozent würden KI-Agenten Vertragsangelegenheiten anvertrauen, nur vier Prozent ein eigenes Budget und drei Prozent vertrauliche Daten. 14 Prozent gehen davon aus, dass die Agenten weniger Fehler machen werden als menschliche Kollegen. Das zeigt, wie groß die Vorbehalte gegenüber der Leistungsfähigkeit der KI-Assistenten ist – und wie groß das Misstrauen gegenüber den Anbietern.
Tech-Firmen wie OpenAI, Anthropic oder Microsoft erhoffen sich großes Potenzial von den Agenten, die eines Tages als vollwertige Teammitglieder in Unternehmen mitarbeiten sollen – und so auch jene Produktivitätsgewinne liefern könnten, die viele Firmenlenker bislang beim Einsatz von KI vermissen. „Agentische KI kann der KI einen ähnlichen Schub verleihen wie das Smartphone dem Internet“, glaubt etwa Tanja Rückert, Chief Digital Officer bei Bosch. Vanessa Cann, Ex-Vorsitzende des KI-Bundesverbands, prognostizierte im Frühjahr, dass KI-Agenten in einigen Monaten oder Jahren die Arbeit ganzer Unternehmensbereiche übernehmen können, von Marketing bis Softwareentwicklung.
Skepsis gegenüber Künstlicher Intelligenz
Laut der Civey-Umfrage trauen auch immerhin 46 Prozent der befragten Manager den KI-Agenten zu, für einen größeren Produktivitätsschub zu sorgen als beispielsweise smarte Maschinen, Quantencomputer oder humanoide Roboter. Mit 51 Prozent blicken auch deutlich mehr Umfrageteilnehmer mit Neugierde auf eine Zukunft mit gemischten Teams aus KI-Agenten und Menschen als mit Skepsis (35 Prozent). Gut die Hälfte hofft auf schnellere Ergebnisse und Entlastung bei beruflichen Tätigkeiten. 20 Prozent gehen von besseren Ergebnissen durch KI-Agenten aus.
Zumindest diese Erwartung deckt sich mit den Ergebnissen einer weiteren Umfrage, die Microsoft unter normalen Angestellten durchführen ließ. Auch unter den mehr als 500 Mitarbeitern ohne Führungsverantwortung, die von der Umfragefirma Yougov befragt wurden, hofft ein Fünftel auf bessere Ergebnisse. Dass die KI-Agenten weniger Fehler als menschliche Kollegen machen werden, glauben nur 16 Prozent. Grundsätzlich haben 35 Prozent ein eher positives Gefühlsbild im Bezug auf den Einsatz von KI-Agenten, eher negativ ist es bei 37 Prozent. 15 Prozent berichten, dass sie bereits mit den smarten Assistenten experimentierten.
BCG sieht 50-Milliarden-Markt
Tatsächlich ist der Einsatz der Agenten in den allermeisten Unternehmen noch Zukunftsmusik. Die Beratungsfirma BCG prognostiziert, dass der Markt von etwa 5 Mrd. Dollar im Jahr 2024 auf über 50 Mrd. Dollar im Jahr 2030 wachsen dürfte. Zu den Anbietern, die von dem Wachstum profitieren wollen, gehört auch DeepL aus Köln. Die Tech-Firma wurde mit ihrer KI-basierten Übersetzungslösung bekannt und 2024 mit 2 Mrd. Dollar bewertet.
Nun will sie in den neuen Markt expandieren, mit einem Agenten, „der die zeitaufwendigen, repetitive Aufgaben übernimmt, mit denen Wissensarbeitende täglich konfrontiert sind“, verspricht CEO Jaroslaw Kutylowski.