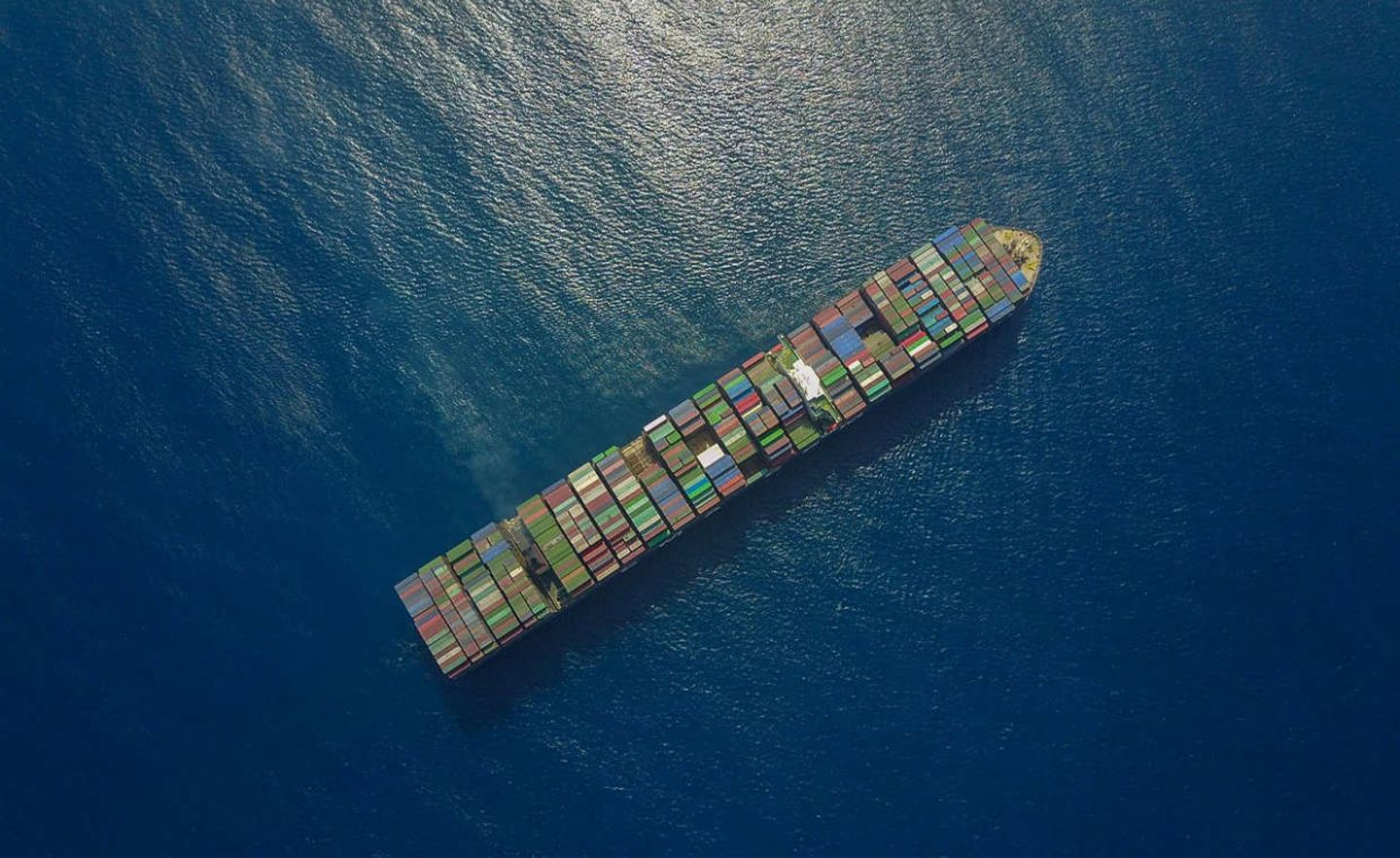Die Weltwirtschaft wird in diesem Jahr mit noch mehr Dynamik als 2017 wachsen. Diese Schlussfolgerung lässt der Blick auf die wichtigsten globalen Frühindikatoren zu, seien es beispielsweise die Frühindikatoren der OECD, die globalen Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor oder auch Umfragen unter Konsumenten. Sowohl in den Industrie- als auch in den meisten Schwellenländern haben sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen bis zuletzt verbessert, sodass sich die Weltwirtschaft erstmals seit langem in einem global synchron verlaufenden Aufschwung befindet. Dieser hat die Tendenz, sich selbst zu verstärken, sodass das globale Wachstum in diesem Jahr abermals positiv überraschen dürfte.
Zyklische Erholung der Weltwirtschaft …
Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009 ist die Weltwirtschaft sehr ungleichmäßig und im Vergleich zu früheren Konjunkturzyklen schwach gewachsen. Statt Zuwachsraten von vier oder fünf Prozent zu erreichen, wuchs die Weltwirtschaft in den vergangenen Jahren gerade einmal mit gut drei Prozent. Für das geringere Wachstum waren zunächst vor allem die Industrieländer verantwortlich, die in den Folgejahren der Krise mit einem starken Anstieg der Staatsverschuldung zu kämpfen hatten. Später kamen dann politische Fehlentwicklungen in einigen Schwellenländern hinzu, die sich wachstumsdämpfend bemerkbar machten, und im Jahr 2015 wurden diese negativen Effekte noch durch den Verfall der Rohstoffpreise verstärkt.
Im vergangenen Jahr sah es dann zeitweise danach aus, als ob dem Aufschwung endgültig die Luft ausgehen würde, nachdem politische Entwicklungen (Brexit-Entscheidung im Juni 2016, US-Präsidentschaftswahl im November 2016) zu einer starken Zunahme der „gefühlten“ wirtschaftlichen Unsicherheit führten. Doch es kam anders. Obwohl der Aufschwung mittlerweile schon mehr als 100 Monate anhält und es bei der Betrachtung der durchschnittlichen Länge eines Konjunkturzyklusses der letzten 70 Jahre längst an der Zeit für einen neuen Abschwung wäre, hat die Konjunkturdynamik sowohl in den Industrie- als auch in den Schwellenländern im Jahresverlauf 2017 positiv überrascht. Für dieses Jahr rechnen wir mit einer Fortsetzung dieser erfreulichen Entwicklung.
… setzt sich 2018 mit höherem Tempo fort
Bislang gibt es keine Anhaltspunkte, die auf ein absehbares Ende der guten Konjunktur hindeuten. Im Gegenteil: Weltweit haben sich fast alle wichtigen konjunkturellen Frühindikatoren im Laufe der vergangenen Monate verbessert. Von daher geht auch der Internationale Währungsfonds in seiner gerade veröffentlichten neuesten Prognose davon aus, dass sich das globale Wachstum in diesem Jahr von 3,7 auf 3,9 Prozent beschleunigt. OECD und Weltbank rechnen ihrerseits ebenfalls mit einer leichten Zunahme der wirtschaftlichen Dynamik im Jahr 2018. Allerdings fällt auf, dass alle drei Organisationen sehr vorsichtig mit ihren Ausblicken bleiben und auf die vielen verbleibenden Risiken hinweisen.
Unseres Erachtens ist es allerdings aufgrund der derzeit zu beobachtenden weltweit starken Konjunkturdynamik sehr wahrscheinlich, dass die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung 2018 wie schon im vergangenen Jahr besser ausfallen wird, als es in diesen Prognosen zum Ausdruck kommt. Die vorsichtige Haltung vieler Prognostiker ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Wachstumserwartungen in den Jahren nach der Finanzkrise fast immer zu optimistisch waren. Mittlerweile hat man die Prognosefehler aus der Vergangenheit erkannt und daraus „gelernt“, vorsichtigere Einschätzungen abzugeben. Doch diese Vorsicht führt in die Irre. Wir rechnen mit einem globalen Wirtschaftswachstum von mehr als vier Prozent.
USA: Aufschwung setzt sich mit mehr Schwung fort …
Nicht nur die Schwellenländer, auch die Industriestaaten profitieren von der zyklischen Erholung der Weltwirtschaft. Die Wachstumsrate der US-Wirtschaft hat sich im Jahr 2017 erwartungsgemäß erhöht. Nach einem Zuwachs von 1,5 Prozent im Jahr 2016 hat die reale Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr um 2,3 Prozent zugenommen. Aufgrund der anhaltend guten Finanzierungsbedingungen und der deutlich verbesserten Stimmungslage bei Unternehmen und Privathaushalten rechnen wir für 2018 mit einem noch etwas stärkeren Plus von 2,6 Prozent. Der Aufschwung in den USA, der laut National Bureau of Economic Research (NBER) im Juni 2009 begonnen hat, geht im Sommer 2018 damit in sein zehntes Jahr.
Ein positiver Wachstumsimpuls wird von der US-Steuerreform ausgehen . Hauptprofiteure werden die Unternehmen sein, sodass die Investitionen in diesem Jahr wohl um mehr als fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr ausgeweitet werden dürften. Die anhaltende Investitionsschwäche, die in den vergangenen Jahren ein entscheidender Grund für das geringe Produktivitätswachstum war, dürfte somit überwunden werden. Zudem profitieren die USA vom starken und beständigen Wachstum des privaten Verbrauchs. Dank der sehr niedrigen Arbeitslosenquote, die 2018 die Marke von vier Prozent deutlich unterschreiten wird, und der rekordhohen Beschäftigung wird der private Verbrauch auch in den nächsten Quartalen mit einer auf das Gesamtjahr hochgerechneten Rate von etwa drei Prozent wachsen.
Ein noch etwas stärkerer Zuwachs wäre möglich, wenn die Löhne stärker steigen würden, als es bislang der Fall ist. So sind die durchschnittlichen Stundenlöhne in der Privatwirtschaft nur 2,3 Prozent höher als vor einem Jahr. Allerdings zeigt sich, dass die Löhne in den unteren Lohngruppen zuletzt stärker angestiegen sind. Da üblicherweise Personen mit geringerem Einkommen eine höhere Konsum- und eine geringere Sparquote haben, sollte sich dies tendenziell positiv auf den privaten Verbrauch auswirken.
… und noch keine Anzeichen für eine neue Rezession
Die These, dass allein schon die Länge der Konjunkturerholung ein Signal für sein baldiges Ende sei, halten wir für falsch. Der bislang längste Aufschwung der US-Geschichte (seit 1950), der von März 1991 bis Februar 2001 anhielt, dauerte immerhin 120 Monate. Von den vier von uns verfolgten Rezessionsindikatoren – die Steilheit der Zinsstrukturkurve, die Jahresveränderungsrate des Frühindikators von Conference Board, die Differenz der Auftrags- und der Lagerbestandskomponente der ISM-Einkaufsmanagerumfrage sowie die Veränderung der Arbeitslosenquote – gibt im Moment keiner ein Warnsignal für einen bevorstehende Abschwung. In der Vergangenheit wurden Rezessionen dagegen immer dann treffsicher angezeigt, wenn mindestens drei der vier Komponenten angeschlagen haben. Im Moment stehen die Ampeln für eine Fortsetzung des Aufschwungs somit auf grün.
In den meisten Fällen hat eine zu restriktive Geldpolitik der US-Notenbank zu einer Rezession geführt. In den 1970er- und 1980er-Jahren waren es darüber hinaus stark steigende Ölpreise, die die Konjunktur abgewürgt haben. Im Moment spielt weder der eine noch der andere Faktor eine große Rolle. Von daher könnte es gut sein, dass der derzeitige Aufschwung eine neue Rekordmarke setzt und mehr als 120 Monate anhält. Dies wäre der Fall, wenn der Aufschwung mindestens noch bis zum Sommer 2019 dauert. Bislang hat die US-Notenbank die Zinsen nur sehr vorsichtig erhöht. Da sie diesen Kurs fortsetzen dürfte, halten wir es für wahrscheinlich, dass es frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2019 zu einer neuen Rezession kommen könnte.
Eurozone: Politische Unsicherheiten treten in den Hintergrund …
Das „Superwahljahr 2017“ hat entgegen mancher Befürchtungen nicht zu einem weiteren Auseinanderdriften der Länder in der Eurozone geführt. Im Gegenteil: Der Brexit und die Trump-Wahl haben die europäischen Bürger mehrheitlich davor zurückschrecken lassen, den mit populistischen Aussagen um die Wählergunst werbenden Parteien ihre Stimme zu geben. Zudem hat die Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in fast allen Ländern dazu geführt, dass die Skepsis gegenüber dem Euro und den Institutionen der EU gesunken ist. Nur in Großbritannien selbst, das mit der Austrittsentscheidung aus der EU eigentlich die Grundlage für eine anhaltende wirtschaftliche Prosperität legen wollte, haben sich die Wirtschaftsdaten in den vergangenen Monaten verschlechtert. Statt weiterhin zu den Ländern mit der höchsten Wachstumsdynamik in Europa zu gehören, ist Großbritannien in den vergangenen Quartalen ans Tabellenende gerutscht.
… und der Arbeitsmarkt erholt sich
Die wirtschaftliche Belebung in der Eurozone hat mittlerweile alle Länder erreicht. Selbst ehemalige Krisenländer wie Griechenland oder Portugal sorgen wieder für positive Schlagzeilen. Ähnliches gilt für die langjährigen „Sorgenkinder“ Frankreich und Italien. Für alle Länder signalisieren die Frühindikatoren für die nächste Zeit eine anhaltende Konjunkturerholung. Somit sollte das reale Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone 2018 nochmal um 2,4 Prozent zulegen. Getragen wird der Aufschwung bislang vor allem von den Exporten, aber auch die Investitionstätigkeit hat sich angesichts niedriger Zinsen und guter Geschäftserwartungen verbessert.
Im Unterschied zu den USA ist die Konjunkturerholung noch nicht sehr weit fortgeschritten. Dies zeigt sich insbesondere an der zwar gesunkenen, aber immer noch hohen Arbeitslosigkeit. So sind in der Eurozone derzeit rund 14,3 Millionen Personen arbeitssuchend gemeldet (verglichen mit 6,6 Millionen in den USA). Vor dem Beginn der Krise lag diese Zahl bei 11,5 Millionen. Aus der Spitze heraus deutlich gesunken ist die Arbeitslosenquote in Spanien (um fast zehn Prozentpunkte), in Irland und Portugal (um jeweils neun Prozentpunkte), aber auch in Griechenland (fast sieben Prozentpunkte). Trotz der Fortschritte ist die Arbeitslosigkeit vor allem in Griechenland, aber auch in Spanien immer noch deutlich höher als es vor dem Jahr 2008 der Fall war. Im Unterschied dazu haben sich die Arbeitsmärkte in Portugal und in Irland fast vollständig erholt. In Deutschland ist die Arbeitslosigkeit heute sogar deutlich niedriger als vor Krisenbeginn.
Da sich diese positive Entwicklung fortsetzen dürfte, wird der private Verbrauch in der Eurozone 2018 um gut zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr zunehmen und damit etwas stärkere Wachstumsimpulse liefern als es in den vergangenen Jahren der Fall war. Die positive Entwicklung des Jahres 2017 sollte sich von daher nicht als Eintagsfliege erweisen.