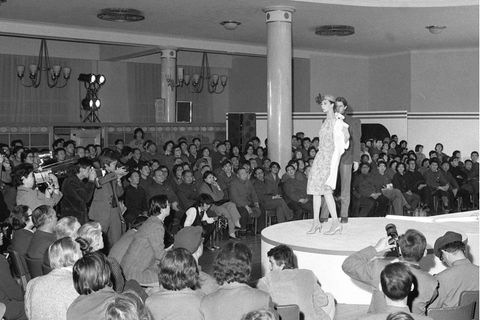Selten war der Ausblick auf ein neues Jahr so verheißungsvoll wie heute. Der Unruhestifter Trump verlässt am 20. Januar das Weiße Haus. Das Corona-Virus bleibt zwar hoch gefährlich, wie die neue Mutation in Großbritannien wieder einmal zeigt. Aber die Liste der Impfstoffe, die innerhalb der kommenden Monate genehmigt werden könnten und es teilweise bereits sind, wird länger. Dies spricht dafür, dass es der Menschheit im Laufe des kommenden Jahres gelingen könnte, die Pandemie so weit in den Griff zu bekommen, dass sie die Wirtschaft ab dem Frühjahr kaum noch belasten muss.
Für 2021 zeichnet sich somit das Ende der beiden außergewöhnlichen Schocks ab, die der Weltwirtschaft in den vergangenen Jahren schweren Schaden zugefügt haben. Der neue US-Präsident Joe Biden ist zwar kein Freihändler. Aber er will mit Verbündeten wie der Europäischen Union, Kanada und Japan eng zusammenarbeiten, statt sie mit Drohungen zu überziehen. Damit dürfte das Risiko eines Handelskrieges zwischen den beiden größten Wirtschaftsräumen der Welt, den USA und der Europäischen Union, vom Tisch sein. Für den Welthandel ist das die beste Nachricht seit mehr als vier Jahren.
Deutschland hat weniger Nachholpotenzial
Für 2021 erwarten wir für die Eurozone und die USA ein Wachstum von jeweils etwa 5%. Dass Deutschland mit etwa 4,4% dahinter zurückbleiben dürfte, liegt vor allem daran, dass es in 2020 nicht ganz so heftig gebeutelt wurde als andere Länder Europas und deshalb weniger Nachholpotenzial hat. Zudem ist der fiskalische Stimulus längst nicht so ausgeprägt wie in den USA, die sich nach einem Fehlbetrag im Staatshaushalt von etwa 16% ihrer Wirtschaftsleistung in 2020 im kommenden Jahr wohl erneut ein horrendes Defizit von etwa 11,5% leisten wollen.
Allerdings müssen wir gerade nach den Schocks der vergangenen Jahre weiterhin auf die Risiken achten, die unseren positiven Ausblick auf das neue Jahr nachhaltig stören könnten. Neben den erheblichen Gefahren, wie weiterhin von der Pandemie ausgehen, sind dies aus heutiger Sicht vor allem fünf Risiken.
Schäden der zweiten Welle weniger ausgeprägt
Erstens setzen wir darauf, dass Haushalte und Unternehmen nach dem Abflauen der zweiten Welle der Pandemie ebenso wie nach dem Ende der ersten Welle schnell bereit sein werden, wieder mehr Geld auszugeben. Sollten sie dagegen vom erneuten Rückschlag im Zuge der zweiten Welle der Pandemie so geschockt sein, dass sie sich daraufhin für lange Zeit bei Konsum und Investitionen zurückhalten, würde sich die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nur langsam erholen können. Da die wirtschaftlichen Schäden der zweiten Welle aber aller Voraussicht nach weit weniger ausgeprägt sein werden als die der ersten Welle, halten wir es für wenig wahrscheinlich, dass das Geschäftsklima und das Verbrauchervertrauen stärker und nachhaltiger in Mitleidenschaft gezogen werden, als das nach der ersten Welle der Fall war.
Zweitens ist zumindest denkbar, dass dem dunklen Winter der Konjunktur eine so ausgeprägte Pleitewelle und eine so kräftige Zunahme der Arbeitslosigkeit folgen könnten, dass dies das Zukunftsvertrauen von Haushalten und Unternehmen erheblich beeinträchtigen könnte. Allerdings ist die Wirtschaftspolitik sich dieser Risiken sehr bewusst. Auch wenn 2021 in Deutschland und Europa wieder vermehrt Insolvenzen zugelassen werden, dürften die staatlichen Hilfen für Unternehmen und den Arbeitsmarkt umfangreich genug bleiben, um einen schockartigen Anstieg der Unternehmenspleiten und der Arbeitslosigkeit zu verhindern.
Kennen Sie schon unseren Newsletter „Die Woche“ ? Jeden Freitag in ihrem Postfach – wenn Sie wollen. Hier können Sie sich anmelden
Drittens könnte die Konjunktur erneut wackeln, wenn die Geld- und Fiskalpolitik zu früh wieder vom Krisen- zum Normalmodus zurückkehren würde. Bisher sehen wir dafür allerdings auf beiden Seiten des Atlantiks keinerlei Anzeichen. Stattdessen zeichnet sich ab, dass die Geldpolitik noch weit über das Jahr 2021 hinaus ausgesprochen expansiv bleiben wird, während die Fiskalpolitik die Konjunktur weiter durch mehr staatliche Investitionen und mehr Neueinstellungen im öffentlichen Sektor stützen wird. Deshalb werden wir uns im Jahr 2021 wohl eher mit der Frage befassen müssen, ob nicht Geld- und Fiskalpolitik auf Dauer über das Ziel hinausschießen könnten.
Mögliches Risiko für 2022
Viertens beruht unser positiver Ausblick vor allem für die Finanzmärkte auf der Annahme, dass die Inflation in der Frühphase des neuen Aufschwungs niedrig bleibt. Würde der Preisauftrieb dagegen so stark zulegen, dass die Anleger damit rechnen müssten, dass die Notenbanken in Kürze gegensteuern, würde ein kräftiger Anstieg der Renditen an den Anleihemärkten die Aktienmärkte unter Druck setzen. Die schöne Phase des Zyklus mit viel Wachstum bei wenig Inflation wäre vorbei. Für 2022 könnte dies ein ernstes Risiko sein. Aber für 2021 zeichnet sich weder ein Kostendruck durch überhöhte Lohnabschlüsse noch ein inflationärer Kaufrausch der Verbraucher ab. Zudem werden die Notenbanken mit Rücksicht auf die weiterhin angespannte Lage in Teilen des Arbeitsmarktes lange zögern, bis sie ihre Politik straffen bzw. einen großen Anstieg der Renditen am Kapitalmarkt zulassen. Ein Inflationsschub, der so kräftig sein könnte, um die Notenbanken bereits 2021 zum Handeln zu zwingen, ist vorläufig noch nicht in Sicht.
Fünftens müssen wir wie üblich die politischen und geopolitischen Risiken im Auge behalten. In Deutschland nähert sich die Ära Merkel ihrem Ende. Ein möglicher Wechsel von der derzeitigen „großen“ Koalition zu einem Bündnis aus Union und Grünen dürfte trotz manch neuer Akzente im Detail jedoch kaum zu einem solch durchgreifenden Politikwechsel führen, dass dies die Konjunktur erheblich beeinträchtigen könnte. Selbst im eher unwahrscheinlichen aber durchaus denkbaren Risikoszenario einer grün-rot-roten Koalition wäre der Politikschwenk zu mehr kostentreibenden Regulierungen zwar eine ernste Gefahr für das langfristige Trendwachstum aber vermutlich noch nicht für die kurzfristige Konjunktur in 2021 und 2022.
Alte und neue Krisenherde
Geopolitisch können jederzeit alte oder neue Krisenherde für Spannungen sorgen. Sollte beispielsweise Chinas seinen in letzter Zeit lauter vorgetragenen Drohungen gegen Taiwan Taten folgen lassen, könnte dies die Welt in erhebliche Turbulenzen stürzen. Allerdings dürfte die Gefahr geopolitischer Großunfälle unter dem neuen US-Präsidenten eher geringer sein als unter seinem erratischen Vorgänger, dessen Absichten nicht immer leicht einzuschätzen waren. Mit einer Supermacht USA, die unter Biden kraftvoll, besonnen und vorhersehbar auftritt und traditionelle Bündnisse pflegt, stehen die Chancen nicht schlecht, dass 2021 sogar etwas mehr Ruhe in die Weltpolitik einkehren könnte.
Auch 2021 werden wir uns wohl auf einige Überraschungen einstellen müssen. Aber nach Trump, Brexit und der Corona-Pandemie könnte die größte Überraschung des Jahres 2021 sein, dass zur Abwechslung mal keine neue Katastrophe die Konjunktur aus dem Tritt bringt.
Holger Schmieding ist Chefvolkswirt der Berenberg Bank. Er schreibt hier regelmäßig über makroökonomische Themen. Weitere Kolumnen von Holger Schmieding finden Sie hier