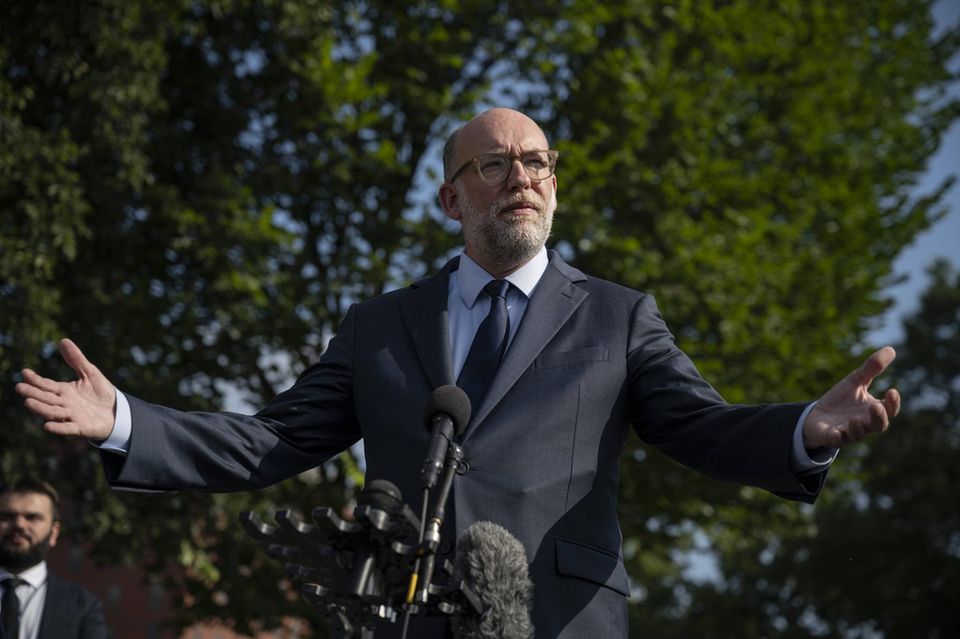Der Ifo-Index sinkt zum dritten Mal in Folge und signalisiert damit eine Rezession in Deutschland. Gleichzeitig wächst die US-Wirtschaft nach den neusten Zahlen aus Washington mit einer Jahresrate von 2,8 Prozent – viel stärker als allgemein von den Experten erwartet. Natürlich liefern diese Daten aus der vergangenen Woche nur eine Momentaufnahme. Und doch liegen sie im Trend:
Die USA präsentieren sich so stark wie seit Langem nicht mehr, die EU und Deutschland fallen zurück. Diese Entwicklung dürfte sich verstärken, sobald die amerikanische Notenbank die Inflation endgültig in den Griff bekommt und die Zinsen senkt – und der Realwirtschaft damit noch mehr Sauerstoff zuführt.
Dabei wird sich die eigentliche Stärke der amerikanischen Realwirtschaft erst in den nächsten zwei, drei Jahren zeigen. In den USA ziehen in- und ausländische Investoren in diesen Monaten so viele neue Fabriken hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Wenn sie erst produzieren, geht es schnell weiter bergauf. Und weil es viele neue, relativ gut bezahlte Jobs gibt, wächst auch die Konsumnachfrage. Man sieht gegenwärtig nichts, was die Kraft des Aufschwungs brechen könnte.
Nur ein Krieg zwischen China und Taiwan kann den US-Aufschwung stoppen
Auch nicht die amerikanischen Wahlen. Zwar stehen sich mit Kamala Harris und Donald Trump Präsidentschaftskandidaten gegenüber, die sich in allem diametral unterscheiden. Auch in der Finanz- und Wirtschaftspolitik. Je nachdem kann die nächste Administration den Aufschwung durch konkrete Maßnahmen bremsen oder beschleunigen. Doch die Richtung der Wirtschaft kann sie kaum verändern.
Wer auch immer sich am Ende im November bei der Wahl durchsetzt, startet in einer deutlich einfacheren wirtschaftlichen und politischen Konstellation als Joe Biden im Januar 2021, der mit der Covid-Epidemie und dem russischen Angriff auf die Ukraine fertig werden musste. Einzig und allein ein Krieg in Fernost, ausgelöst durch einen chinesischen Angriff auf Taiwan, könnte jetzt die Rechnung der nächsten Regierung in Washington durchkreuzen.
Strukturell sind die positiven Triebkräfte zu stark, um sie politisch wieder umzudrehen. Wir stehen vor einem amerikanischen Jahrzehnt, wenn nicht etwas völlig Unerwartetes passiert. In den USA siedeln sich wieder traditionelle Industrien an, die seit Langem auf dem absteigenden Ast schienen. Gleichzeitig führen die USA mit großem Abstand bei der wichtigsten neuen Industrie: der Künstlichen Intelligenz. Und der Staat nimmt sehr viel Geld in die Hand, um Unternehmen ins Land zu ziehen, die sonst vielleicht nicht kommen würden – vor allem in der Chipindustrie. Alle drei Trends verstärken sich gegenseitig und sichern den Aufschwung.
Die Europäer haben in den vergangenen zwei Jahren mit Verwunderung und Verachtung auf die merkwürdigen politischen Gefechte in den USA geblickt – und sich zuletzt von den amerikanischen Medien mit ihrem Dauerfeuer auf die „Amtsunfähigkeit“ Joe Bidens anstecken lassen. Dabei haben sich die Bidenomics als die wahrscheinlich erfolgreichste Wirtschaftspolitik seit der Zeit Ronald Reagans erwiesen. Gerade Deutschland hat es versäumt, sich daran ein Beispiel zu nehmen. Der 81-jährige Biden versteht mehr von moderner Industrie- und Wirtschaftspolitik als ein jüngerer Olaf Scholz oder ein Emmanuel Macron.