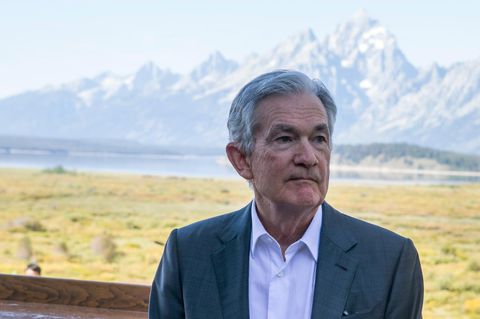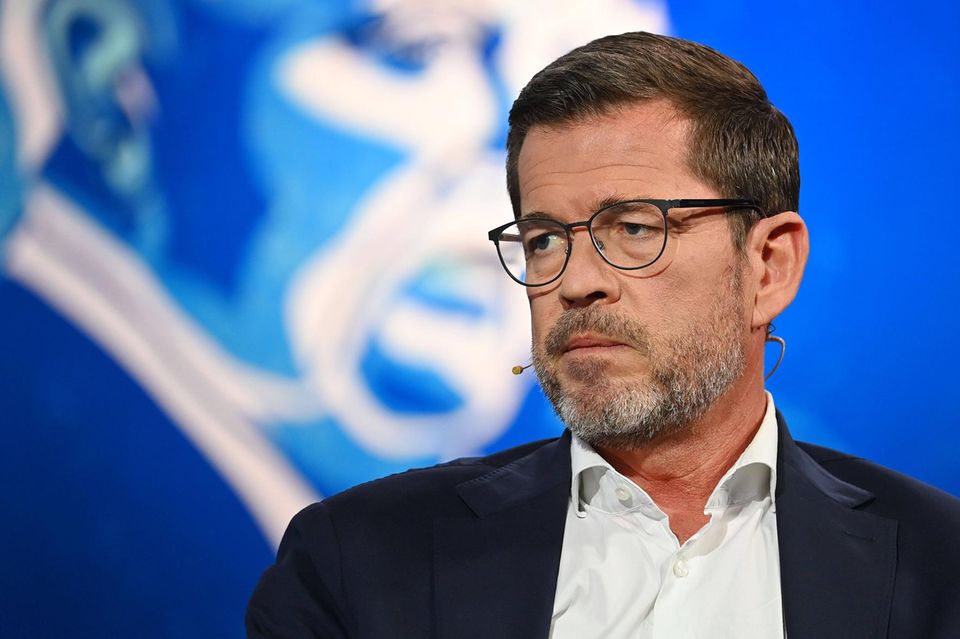Das Motto „Whatever it takes“ des bisherigen Chefs der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, dürfte auch in Zukunft die Geldpolitik in Europa bestimmen. Denn mit der Wahl von Christine Lagarde zur Nachfolgerin Draghis wird eine Frau zur Währungshüterin, die sich schon während der Rettung Griechenlands durchaus pragmatisch zeigte:
„Wir haben alle Regeln verletzt, weil wir die Reihen schließen und die Eurozone wirklich retten wollten“, sagte sie im Jahr 2010, damals noch als französische Finanzministerin. Marktexperten gehen davon aus, dass sie auch als neue EZB-Chefin auf eine Rettung des Euros aus ist – und die ultralockere Geldpolitik von Draghi fortführt.
Mit Lagarde niedrigen Zinsen
Als Anfang Juli klar wurde, dass die derzeitige Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) EZB-Präsident Mario Draghi im Herbst ablösen soll, reagierte deshalb vor allem der europäische Kapitalmarkt erfreut. Der Dax erreichte mit 12.637 Punkten seinen bisherigen Höchststand in diesem Jahr.
„Lagardes Nominierung stellt kein Risiko für die Finanzmärkte dar“, ist Christian Nemeth, Chefanlagestratege der Zürcher Kantonalbank Österreich, überzeugt. „Es ist zu erwarten, dass Lagarde die wenig restriktive und lockere Geldpolitik von Mario Draghi fortsetzt, wenngleich der Spielraum begrenzt ist.“
Mit der 63-jährigen Lagarde als EZB-Präsidentin stehen also alle Zeichen weiterhin auf niedrigen oder gar sinkenden Zinsen . Mark Dowding, Partner bei der britischen Fondsgesellschaft Bluebay Asset Management, rechnet bereits im Juli mit einer Zinssenkung.
Vor Lagardes Amtsantritt würden noch einige schwierige Schritte in Angriff genommen werden, damit die Französin nicht gleich zu Beginn vor großen Herausforderungen stehe. „Daher erwarten wir, dass noch in diesem Monat die Zinsen um zehn Basispunkte gesenkt werden“, sagt Dowding.
Konsequenz: Der Zins für zehnjährige Bundesanleihen sank vergangenen Donnerstag auf ein neues historisches Tief von minus 0,4 Prozent. Wer dem deutschen Staat Geld verleiht, bekommt also am Ende weniger zurück als er investiert hat.
Experte rechnet mit wachstumsfreundlicher Politik
Setzt die EZB unter Lagarde die „Whatever-it-takes“-Geldpolitik fort, dann könnte sie zudem bald wieder verstärkt Staatsanleihen aufkaufen. Das würde das Anleiheangebot auf den Märkten künstlich verknappen, die Preise erhöhen und die Renditen noch weiter senken. Sinkende Renditen verringern die Finanzierungskosten für die Wirtschaft und könnten die Konjunktur stützen.
Gleichzeitig könnte die EZB abermals den Einlagenzins für Banken senken. Dieser ist schon jetzt negativ. Das bedeutet: Wenn Geschäftsbanken überschüssige Liquidität bei der EZB lagern, bekommen sie dafür keine Zinsen mehr, sondern müssen gewissermaßen eine Strafe zahlen. Auch das soll letztlich dazu führen, dass mehr Geld in die Wirtschaft fließt.
Denn statt Liquidität bei der EZB zu bunkern, hätten die Banken ein größeres Interesse daran, anderen Banken oder Unternehmen Kredite zur Verfügung zu stellen. Christian Nemeth von der Zürcher Kantonalbank ist überzeugt, dass es zu diesem Schritt kommen wird – er rechnet mit einer Senkung des Einlagenzinses von minus 0,4 Prozent auf minus 0,5 Prozent.
Christine Lagarde ist keine Ökonomin, sondern Juristin. Sie gilt durch ihre bisherige Position als IWF-Chefin aber als bestens vernetzt in der Finanzwelt, so dass die fehlende Ausbildung Marktbeobachter nicht schreckt. „Die EZB hat ohnehin schon genügend kompetente Ökonomen“, kommentiert Mark Holman, CEO von Twentyfour Asset Management, einer Tochter von Vontobel.
Lagarde besitze ein ähnliches politisches Geschick wie ihr Amtsvorgänger Draghi. „In ihrer letzten Amtszeit im IWF appellierte sie wiederholt an die Nationen, mehr dafür zu tun, um ihre Volkswirtschaften anzukurbeln, entweder durch Geldpolitik, Fiskalexpansion oder Strukturreformen“, sagt Holman. Jetzt, wo sie den geldpolitischen Hebel bald in der Hand hat, dürfte Lagarde ihn auch dementsprechend nutzen.
Auch mit Hinblick auf die Nominierung der CDU-Politikerin Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin fasst Bluebay-Partner Dowding die nähere Zukunft in Europa so zusammen: „Die EU-Agenda dürftig künftig eher wachstumsfreundlicher, mit weniger Abgaben und einer moderaten Geldpolitik ausfallen.“