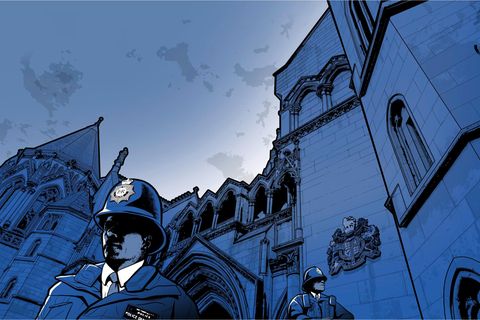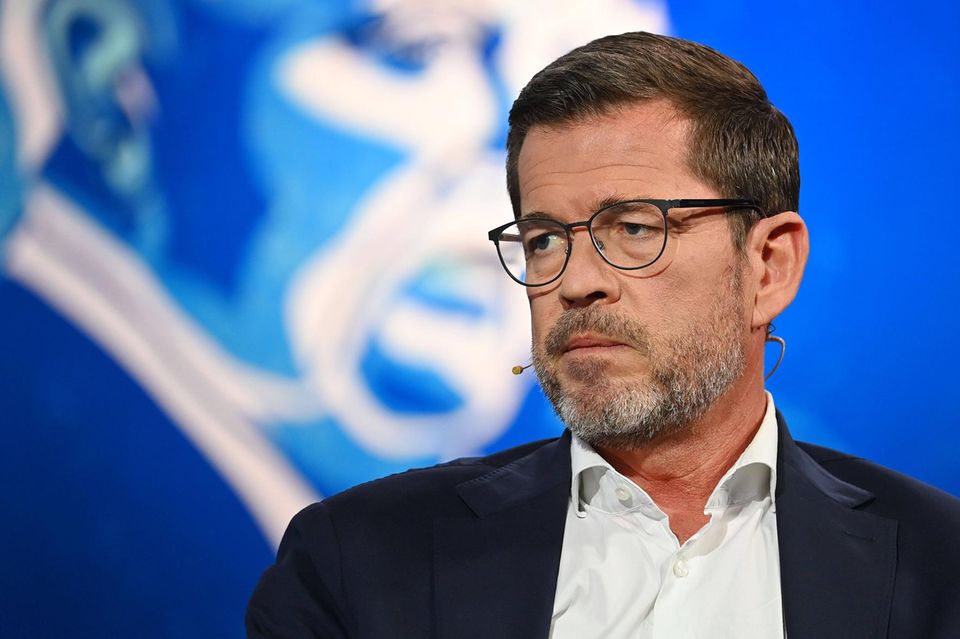Capital: Herr Heinemann, der Westen hat umfangreiche Finanzsanktionen gegen Russland verhängt. Beendet hat er den Krieg damit aber nicht – im Gegenteil: Russland tritt noch aggressiver in der Ukraine auf. Kann man sagen, dass die Sanktionen gescheitert sind?
FRIEDRICH HEINEMANN: So würde ich das nicht sagen. Letztlich kommen die Sanktionen ja in der Realwirtschaft an. Man sollte aber ganz genau schauen, wo die Sanktionen ansetzen und wie Russland darauf reagiert. Und hier muss ich feststellen: Es ist wirklich bemerkenswert, wie Russland sich offenbar frühzeitig auf diese Finanzsanktionen vorbereitet hat.
Das müssen Sie erklären…
Russland handelt seit vielen Jahren fiskalpolitisch konservativ. Der Staatshaushalt ist ausgeglichen und das Land damit weitestgehend unabhängig von internationalen Kapitalmärkten. Außerdem hat die Regierung permanent einen Außenhandelsüberschuss erzielt. Davon profitiert jetzt der Rubelkurs, denn es gibt immer noch Rubelnachfrage aus dem Ausland. Und drittens macht die Zentralbank einen cleveren konservativen Job. Nachdem die Inflation auf gut 17 Prozent hochgegangen ist, hat sie die Leitzinsen auf bis zu 20 Prozent angehoben. Das zeigt, wie handlungsfähig sie ist – auch mit unpopulären Maßnahmen. Und die Situation ist damit auch anders als etwa in der Türkei, wo der Präsident die Anweisungen gibt und viel zu niedrige Zinsen befiehlt. Die russische Zentralbank verhindert so eine Hyperinflation. Solche Signale sind für Investoren ein Asset an Glaubwürdigkeit und zeigen, dass die russische Regierung ökonomisch cleverer agiert als beispielsweise Erdogan.
Welche Finanzsanktionen waren dann überhaupt sinnvoll?
Der Ausschluss mancher Banken aus dem Swift-System war auf finanzieller Seite kein besonders wirkungsvoller Akt. Realwirtschaftlich kann das aber schon einen Effekt haben. Etwa wenn sich ein Mittelständler zurückzieht, weil ihm der Zahlungsverkehr zu kompliziert geworden ist. Theoretisch würde auch das Einfrieren der russischen Devisenreserven in vielen Staaten Probleme bereiten. Dagegen will die russische Zentralbank ja rechtliche Schritte einleiten. Der Haken ist, dass die Devisen in erster Linie dafür da sind, die eigene Währung zu stützen. Und da Russland weiterhin Nachfrage aus dem Ausland hat, braucht sie die Devisen eigentlich nicht. Sie erkauft sich die Stabilität stattdessen mit hohen Zinsen.
Die Leitzinsen wurden zuletzt zwar auf 17 Prozent abgesenkt. Und trotzdem: Zu den Konditionen und unter den politischen Rahmenbedingungen investiert doch niemand. Oder etwa doch?
Ganz klar: Die hohen Zinsen werden das Wachstum stark dämpfen. Für die russische Ökonomie sind es dramatische Wochen. Und auch mit niedrigeren Zinsen lassen sich Investitionen kaum stimulieren. Als Investoren kommen wenn überhaupt nur noch russische Unternehmen infrage. Westliche Unternehmen werden dagegen auf absehbare Zeit keinen Euro oder Dollar mehr in dieses Land stecken. Und wenn sich westliche Unternehmen aus Russland verabschieden, dann trifft das auch die Menschen vor Ort.
Also wirken die Sanktionen ökonomisch gesehen doch?
Ja, aber über die Zeit und nicht unbedingt über die ursprüngliche Finanzsanktion. Das Ganze funktioniert viel mehr darüber, dass sich westliche Unternehmen aus Russland rauslösen – also decouplen. Für die Firmen ist das mittlerweile eine Imagefrage. Und diese Entscheidung privater Unternehmen könnte viel entscheidender werden als jede Finanzsanktion. Wir haben beim Brexit viele Jahre diskutiert, was das milde Decoupling der Briten für negative Folgen haben könnte. Jetzt sprechen wir aber von ganz anderen Dimensionen in viel kürzerer Zeit.
Auf was müssen sich die Russen denn einstellen?
Die Bevölkerung muss damit rechnen, dass 20 Prozent ihrer Kaufkraft verloren geht. Viele Jobs werden vernichtet, wahrscheinlich sind viele Job-Verluste noch versteckt. Das trifft alle – auch den Mittelstand, der gerne mal Urlaub im europäischen Ausland gemacht hat. Das ist bald wohl nicht mehr drin. Da wird es dann auch schwer, das Satisfaktionsniveau der Bevölkerung zu halten. Was wir derzeit schon erleben, ist, dass die klugen Köpfe das Land verlassen und ihrem Arbeitgeber folgen. Beispielsweise aus dem IT-Cluster in St. Petersburg. So etwas wirft Russlands Entwicklungsperspektive natürlich massiv zurück und könnte für Putin zum Problem werden.
Die russische Zentralbankchefin Elvira Nabiullina hat jetzt erklärt, dass sich Unternehmen spätestens ab Sommer neue Geschäftsmodelle oder Absatzwege suchen müssten. Wie kann so ein Strukturwandel aussehen?
Russland wird jedenfalls nicht den nordkoreanischen Weg gehen – sich also vollständig isolieren. Dazu beruht das russische Geschäftsmodell viel zu sehr auf Rohstoffexporten. Hinzu kommt die Abhängigkeit bei Schlüsseltechnologie, die importiert werden muss. Zunächst einmal braucht Russland eine positive Perspektive, erst dann kann der Umbau beginnen. Langfristig wird sich Russland wohl als fossiler Lieferant für den asiatischen Raum positionieren. Aber viel mehr als das wird es wohl nicht. Alles, was wirklich zur Zukunft beiträgt, hat China schon selbst. Und der Umbau zum asiatischen Energielieferanten wird dauern. Wahrscheinlich mehrere Jahre. Und nicht zuletzt wird Russland dadurch strukturell verlieren. Verhungern muss in Russland aber niemand. 80 Prozent der Kaufkraft wird bleiben. Die Überlebensfrage für Putin ist, ob die Bevölkerung das auf Dauer akzeptieren wird.