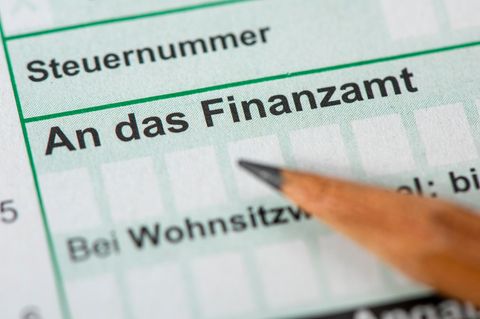Seit ihrer Reform ärgert die Grundsteuer viele Immobilienbesitzer, nicht wenige hatten Einsprüche eingelegt, einige sogar geklagt. Nun hat der Bundesfinanzhof die Berechnung der neuen Grundsteuer nach dem Bundesmodell beanstandet: Hat das Finanzamt den Grundsteuerwert eines Grundstücks so hoch angesetzt, dass es erheblich über das normale Maß hinausgehe, sollen sich die betroffene Eigentümer dagegen wehren können. Sie müssen die Möglichkeit bekommen, einen niedrigeren gemeinen Wert nachzuweisen. Das gelte auch, wenn das Bundesmodell eine solche Korrekturmöglichkeit nicht vorsehe, stellte das Gericht fest (Aktenzeichen II B 78/23 und 79/23).
Zu hohe Werte durch Pauschalierungen und Typisierungen
Konkret verhandelte das oberste deutsche Steuergericht zwei Fälle aus Rheinland-Pfalz. Das Bundesland wendet das Bundesmodell an, das mit zahlreichen Pauschalierungen und Typisierungen arbeitet. Und genau das führte zu Problemen, die vor Gericht Thema waren.
Im ersten Verfahren ging es um das Haus einer Klägerin, das 1880 errichtet wurde, seit Jahrzehnten unrenoviert war und noch einfachverglaste Fenster hatte. Während der zuständige Gutachterausschuss den Bodenrichtwert für das 351 Quadratmeter große Grundstück mit 125 Euro pro Quadratmeter ermittelte, also knapp 44.000 Euro, zog das Finanzamt den gesetzlich normierten Mietwert heran und setzte den Grundsteuerwert auf 91.600 Euro fest. Dabei war fraglich, ob sich mit einem Haus, das sich in einem solchen Zustand befindet, überhaupt Mieterträge erzielen lassen.
Im zweiten Streitfall ging es um ein 178 Quadratmeter großes Einfamilienhaus, das 1977 auf einem 1053 Quadratmeter großen Grundstück errichtet wurde. Davon war aber nur ein Teil nutzbar, unter anderem wegen einer besonderen Hanglage. Das Finanzamt gewährte dennoch keinen Abschlag auf den Bodenrichtwert von 300 Euro pro Quadratmeter, sondern berücksichtigte ihn komplett und stellte den Grundsteuerwert auf 318.800 Euro fest.
Schon beim Finanzgericht erfolgreich
Beide Eigentümer hatten zunächst beim Finanzgericht Rheinland-Pfalz im Eilverfahren beantragt, die ermittelten Grundstückswerte auszusetzen – mit Erfolg. Nun stellte sich auch der Bundesfinanzhof auf die Seite der Klägerin und des Klägers: Natürlich müssten die Finanzämter pauschale Annahmen treffen, um für die über 36 Millionen zu bewertenden Grundstücke in Deutschland Berechnungen anzustellen – anders sei die Masse kaum zu bewältigen.
Doch wenn der vom Finanzamt festgestellte Grundsteuerwert wie in den verhandelten Fällen erheblich über das normale Maß hinausgehe, müssten Eigentümer dem Finanzamt einen niedrigeren Wert nachweisen können. Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs sei das Übermaßverbot verletzt, wenn der ermittelte Wert den tatsächlichen Wert „um 40 Prozent oder mehr“ übersteigt. Es müsse für Betroffene eine Korrekturmöglichkeit geben, „auch wenn der Gesetzgeber einen solchen Nachweis nicht ausdrücklich geregelt habe“.
Kläger müssen Grundsteuer vorerst nicht zahlen
Für die Kläger in beiden Fällen bedeutet das Urteil, dass sie bis auf Weiteres keine Grundsteuer zahlen müssen, die angefochtenen Grundsteuerwertbescheide sind von der Vollziehung ausgesetzt. Für alle anderen Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer in Deutschland ist das Urteil zumindest ein gutes Signal.
Über eine andere Frage haben die obersten Richterinnen und Richter für Steuerangelegenheiten allerdings nicht entschieden: Ob die Grundsteuerreform verfassungsmäßig ist oder nicht, ließen sie offen. Deshalb wird sich voraussichtlich das Bundesverfassungsgericht nochmal mit den beiden Fällen befassen müssen. Für den Bund der Steuerzahler und den Eigentümerverband Haus und Grund, die die beiden Verfahren unterstützt hatten, bestehen weiterhin verfassungsrechtliche Zweifel an der Reform. Sie wollen die beiden Musterverfahren nach Karlsruhe bringen.
Reform läuft seit 2018
Dass die Grundsteuerregeln veraltet sind und reformiert werden müssten, hatte das Bundesverfassungsgericht schon 2018 festgestellt: Die bis dahin herangezogenen Einheitswerte, die teilweise noch aus den 1960er-Jahren stammten, spiegelten den tatsächlichen Wert der Grundstücke nicht mehr wider. Die damalige Bundesregierung brachte eine Reform auf den Weg und ließ die Bundesländer wählen: sie konnten das Bundesmodell nutzen – dafür haben sich elf Länder entschieden – oder individuelle Anpassungen im Rechenmodell vornehmen, was etwa Bayern und Hamburg nutzten.
In jedem Fall sind die Grundsteuererklärungen, die alle Immobilieneigentümer in den vergangenen zwei Jahren einreichen mussten, grundlegend für die Neuberechnung. Die Finanzämter berechneten daraufhin auf den Stichtag 1.1.2022 für jedes Grundstück einen Grundsteuerwert, der den bisherigen Einheitswert ersetzte. Auf dieser Grundlage erheben ab 2025 die Kommunen die neue Grundsteuer.