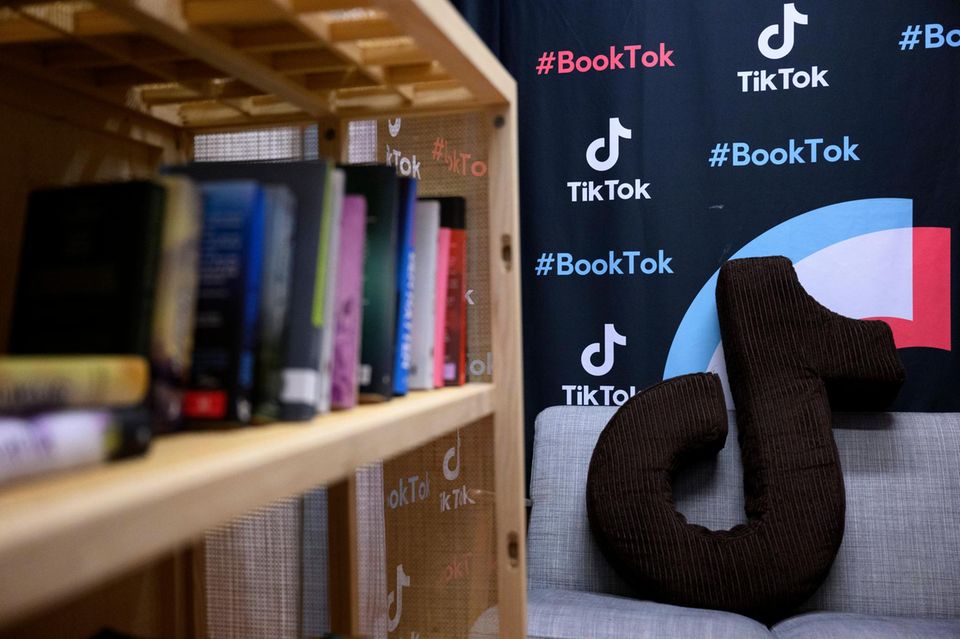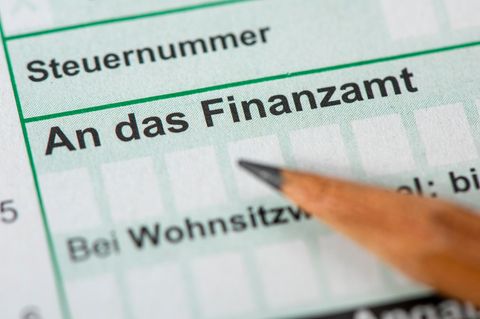Die Grundsteuer ist und bleibt ein Streitthema. Aktueller Aufreger: die zukünftigen Hebesätze der Kommunen, die über die endgültige Höhe der jeweiligen Grundsteuer entscheiden. Denn mittlerweile zeichnet sich insbesondere in großen Städten ab, dass die Reform Wohneigentümer mehr belasten wird als Gewerbeeigentümer.
Doch der Bund will trotz lauter Forderungen aus den Bundesländern nicht eingreifen. Die Länder hätten genügend rechtlichen Spielraum, das Modell zur Steuerberechnung selbst an regionale Bedürfnisse anzupassen. Dies teilt Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) seinen Kollegen aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz in einem Brief mit, der Capital vorliegt. Er appelliert an die Länder, die notwendigen Schritte zügig einzuleiten, wenn sie noch Nachbesserungsbedarf erkennen sollten.
Reform könnte Wohneigentümer mehr belasten
Ab 2025 wird die Grundsteuer nach neuen Regeln berechnet. Zur Reform hatte das Bundesverfassungsgericht die damalige Regierung schon 2018 verdonnert. Grundlage für die Neuberechnung waren die Grundsteuererklärungen, die alle Immobilieneigentümer in den vergangenen zwei Jahren einreichen mussten. Die Finanzämter berechneten daraufhin für jedes Grundstück einen Grundsteuerwert, der den bisherigen Einheitswert ersetzte.
Nun, da die Finanzämter nahezu alle Grundsteuerwertbescheide erlassen haben, zeichnet sich eine Schieflage ab: Der Wert von Wohngrundstücken ist seit der letzten Einheitsbewertung in den 1960er-Jahren deutlich stärker gestiegen als der von Gewerbegrundstücken. Das heißt, dort wo Wohneigentum einen hohen Wertzuwachs erfahren hat, müssen Wohnungs- und Hauseigentümer künftig womöglich draufzahlen, während Gewerbetreibende entlastet werden könnten.
Dabei hatte die Politik versprochen, die Reform falle unterm Strich „aufkommensneutral“ aus. Ländern und Kommunen sollen weiterhin ihre notwendigen Grundsteuereinnahmen sichern können, ohne die Bürgerinnen und Bürger insgesamt stärker zu belasten. Das Wörtchen „insgesamt“ legt ein häufiges Missverständnis offen, denn Aufkommensneutralität bedeutet, dass die Höhe der kommunalen Grundsteuereinnahmen nach der Reform ähnlich hoch ausfallen soll wie zuvor. Es heißt aber nicht, dass jeder Immobilieneigentümer ab 2025 dieselbe Grundsteuer zahlt wie zuvor. Dass es bei einigen zu Mehr- oder Minderbelastungen kommen könnte, war eingepreist.
Hebesatz als verbleibender Hebel
Um zumindest unangemessene Belastungsverschiebungen zulasten der Eigentümer zu vermeiden, forderten einige Bundesländer eine Lösung vom Bund. Dieser sollte eine bundesgesetzliche Grundlage schaffen, damit Kommunen die Grundsteuer aufspalten und unterschiedliche Hebesätze für Wohn - und Gewerbeeigentum festlegen dürfen. So könnten die Städte und Gemeinden auf die jeweiligen konkreten Gegebenheiten vor Ort reagieren und bei überproportionalen Belastungen für Wohneigentum nachjustieren. Das Problem tritt schließlich nicht flächendeckend, sondern kommunal sehr unterschiedlich auf.
Dem Begehren erteilt Bundesfinanzminister Lindner nun eine eindeutige Absage: Soweit einzelne Länder es für erforderlich hielten, könnten sie das Hebesatzrecht eigenverantwortlich per Landesgesetz verändern. Die Grundsteuerreform aus dem Jahr 2019 gebe den Ländern „genügend Spielräume, vom Bundesmodell abzuweichen“, um damit auf regionale Bedürfnisse zu reagieren. Lindner ermuntere die Länder dazu, „notwendige Änderungen im Landesrecht aktiv auszuschöpfen“.
Die „Öffnungsklausel“, auf die sich Lindner in dem Schreiben bezieht, haben bereits einige Länder genutzt, und landeseigene Regelungen über die Bewertung von Grundbesitz und die Grundsteuerberechnung getroffen. So haben etwa Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen eigene Landesmodelle aufgestellt. Währenddessen verfolgt zum Beispiel das Land Berlin zwar das Bundesmodell, hat aber die Steuermesszahl – eine weitere maßgebliche Rechengröße – zu Gunsten der Wohngrundstücke angepasst.
Nordrhein-Westfalen macht notfalls einen Alleingang
„Eine bundesgesetzliche Regelung wäre sowohl mit Blick auf die Zeitschiene wie auch mit Blick auf die Rechtssicherheit mit erheblichen Unsicherheiten behaftet“, schrieb der Bundesfinanzminister in seiner Antwort auf das Begehren des nordrhein-westfälischen Finanzministers Marcus Optendrenk und seiner Kollegin aus Rheinland-Pfalz, Doris Ahnen. Eine Lösung auf Bundesebene würde außerdem dazu führen, dass insbesondere die Länder, die bereits komplett oder in Teilen vom Bundesmodell abgewichen sind, erneut nachjustieren müssten.
Nordrhein-Westfalens Finanzminister Optendrenk dürfte auf die Absage aus Berlin vorbereitet gewesen sein. Bereits Mitte März sagte er im Gespräch mit der „Rheinischen Post“, dass das Land von seinen Möglichkeiten Gebrauch machen und eine entsprechende Regelung eigenständig umsetzen werde, sollte es im Bund nicht mit einer Öffnungsklausel klappen.