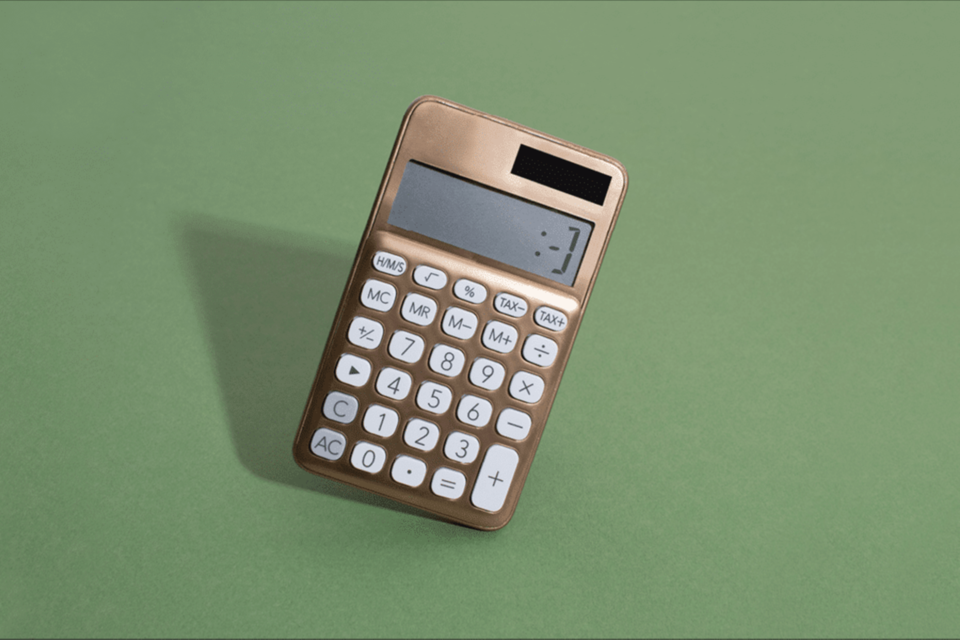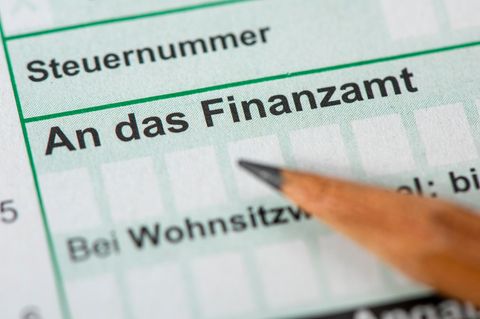Der Berliner Finanzsenator Stefan Evers (CDU) hat angekündigt, den Grundsteuer-Hebesatz in der Hauptstadt ab 2025 von 810 Prozent auf 470 Prozent senken zu wollen. Damit versucht der Senat, die künftige Grundsteuer auf einem verträglichen Niveau zu halten. Schließlich habe man versprochen, „dass Berlin sich durch die Reform der Grundsteuer nicht bereichern wird“.
Berlin sei es als erstes Bundesland gelungen, zum Ende des Jahres 2023 nahezu alle Grundsteuerwertbescheide zu erlassen, heißt es. Doch man habe festgestellt, dass die Finanzämter für die Eigentümer Grundstückswerte in vielfacher Höhe ihres bisherigen Wertes ermittelt hätten. Das habe auch Mieterinnen und Mieter beunruhigt, auf die die Grundsteuer umgelegt wird. Um untragbare Mehrbelastungen zu vermeiden, will der Senat nun an der Stellschraube des Hebesatzes drehen, der die spätere Grundsteuer maßgeblich beeinflusst.
Doch Berlin bleibt vorerst die einzige Großstadt, deren Hebesatz-Pläne für 2025 konkreter werden. Alle Berliner mit Eigenheim oder Eigentumswohnungen können sich zwar nun ihre zukünftige Steuerlast mit folgender Formel selbst ausrechnen: Grundsteuerwert x 0,00031 (Steuermesszahl) x 4,7 (Hebesatz). Doch viele andere Städte erhöhten den Hebesatz zuletzt kräftig. Dass Berlin den Trend bei der Grundsteuer vorgibt, ist also keinesfalls ausgemacht.
Höhe der Grundsteuer oft unklar
Die neue Grundsteuer sorgt landesweit für Ärger und Unsicherheit. Denn bislang weiß niemand genau, wie teuer es am Ende wird. Nachdem alle Grundstückseigentümer im vorletzten Jahr komplizierte Erklärungen ausfüllen mussten, flattern ihnen seitdem Bescheide ins Haus. Diese geben ihnen den neuen Grundsteuerwert ihres Grundstücks, Hauses oder Wohnung bekannt.
Der Grundsteuerwert ersetzt den bisherigen Einheitswert, den das Bundesverfassungsgericht 2018 für überholt und verfassungswidrig erklärt hatte. Doch wie viel Grundsteuer ab 2025 tatsächlich fällig wird, können die rund 20 Millionen Wohnungseigentümer hierzulande aus dem Bescheid des Finanzamtes trotzdem nicht ablesen. Ihnen fehlt der entscheidende Grundsteuer-Hebesatz – eine Prozentzahl, die ganz am Ende der Berechnung obendrauf kommt.
Eigentümerinnen und Eigentümer erfahren den für sie geltenden Hebesatz erst mit dem Grundsteuerbescheid, den die Kommunen verschicken.
Viele Städte erhöhen Hebesatz
Als das Bundesverfassungsgericht die Regierung zur Grundsteuerreform verdonnerte, war Kanzler Olaf Scholz noch Finanzminister. Er versprach den Steuerbürgern 2018, dass trotz neuer Regeln nicht mehr zu bezahlen sei als zuvor. Die Neuberechnung werde „aufkommensneutral“ sein. Doch die Neubewertung der Grundstücke führt im Vergleich zu den vorherigen Einheitswerten zu stark gestiegen Grundsteuerwerten. Um Aufkommensneutralität zu gewährleisten, müssen die Kommunen den von ihnen beeinflussbaren Rechenfaktor – ihre Hebesätze – senken. Und zwar stark.
Doch die vergangenen Monate lassen daran zweifeln, dass dies geschieht. Viele Kommunen hoben stattdessen ihre Steuersätze an und langten zuletzt so kräftig zu wie selten zuvor. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) unter allen Gemeinden in Deutschland mit mehr als 20.000 Einwohnern. Der Bundesdurchschnitt des Grundsteuer-Hebesatzes stieg von 549 auf 554 Prozent. 17 von 701 untersuchten Orten erhöhten ihren Hebesatz um mehr als 100 Punkte. So legte das hessische Bad Homburg v. d. Höhe beim Hebesatz um 345 Prozentpunkte zu, in Xanten in Nordrhein-Westfalen waren es 200 Punkte.
Ob Kommunen ihre Hebesätze zum Jahr 2025 wieder senken, wenn sie diese auf die neuen, mitunter höheren Grundsteuerwerte anwenden könnten, bleibt abzuwarten. Schließlich sind viele deutschen Kommunen chronisch knapp bei Kasse und die Grundsteuer stellt ihre Haupteinnahmequelle dar, um Kindergärten, Feuerwehr und Sportstätten zu finanzieren.
Sinkende Hebesätze bislang die Ausnahme
Die Umfrage der DIHK ergab, dass 2023 lediglich acht von 701 Orte ihren Hebesatz gesenkt haben, darunter Freudenstadt in Baden-Württemberg (minus 50 Prozentpunkte) und das nordrhein-westfälische Troisdorf (minus 35 Prozentpunkte). Andernorts gibt es im Hinblick auf die neue Grundsteuer ab 2025 zumindest Gespräche über eine zukünftige Hebesatzsenkung. So etwa im nordrhein-westfälischen Herten, wo die SPD einen entsprechenden Antrag in den Rat eingebracht hat.
Grundsteuerreform ist umstritten
Die Grundsteuerreform hatte von Beginn an Kritik auf sich gezogen. Steuerexpertinnen und -experten hielten das Bundesmodell schon früh für besonders kompliziert. Fünf Bundesländer – Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen – entschieden sich deshalb, ihr eigenes Grundsteuergesetz zu erlassen oder das Bundesmodell zu verändern.
Gegen das Bundesmodell formierten sich auch Lobbyverbände wie Haus & Grund und der Bund der Steuerzahler. Um den Druck auf die Politik zu erhöhen, riefen zahlreiche Kritiker der Grundsteuerreform Grundstücksbesitzerinnen und -besitzer auf, unbedingt Einspruch gegen ihren Grundsteuerwertbescheid einzulegen und so eine „Klagewelle“ zu provozieren.
Tatsache ist, dass Steuerpflichtige den Grundsteuerwertbescheid unbedingt zeitnah und aufmerksam prüfen sollten, indem sie ihn genau mit den Daten aus der Steuererklärung vergleichen. Enthält der Grundsteuerwertbescheid tatsächlich Fehler, bleibt nach Bescheiderhalt nur ein Monat lang Zeit für einen Einspruch. Gründe für fehlerhafte Bescheide können etwa ein falscher Bodenrichtwert oder falsche Quadratmeterzahlen zur Wohn- und Grundstücksfläche sein.
Kein genereller Einspruch sinnvoll
Für Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ist es jedoch keinesfalls sinnvoll, einen generellen Einspruch gegen den Grundsteuerwertbescheid aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken einzulegen. Diese lehnen Finanzämter höchstwahrscheinlich ab. Dann bleibt nur noch die Klage vor Gericht. Wer das tut, kann immerhin auf den Beistand der Lobbyverbände hoffen, die Klagen gegen die Grundsteuerreform unterstützen. Der Bund der Steuerzahler sowie Haus & Grund sind mittlerweile bei Verfahren in Berlin, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfahlen dabei.
Immerhin gab das Finanzgericht Rheinland-Pfalz in zwei Fällen den Steuerzahlenden bereits recht. Die Grundstückseigentümer hatten sich gegen die Neubewertung ihrer Einfamilienhäuser nach dem Bundesmodell gerichtet. Nun muss die nächsthöhere Instanz, der Bundesfinanzhof, über die Sache entscheiden (Az. II B 78/23 (AdV) und II B 79/23 (AdV)).
Sollte es in den kommenden Jahren ein Verfahren bis zum Bundesverfassungsgericht schaffen und die Richter und Richterinnen die Grundsteuerreform schlussendlich kippen, würde das Urteil allerdings für alle Bescheide gelten und nicht nur für diejenigen Eigentümer, die Einspruch beim Finanzamt eingelegt haben.