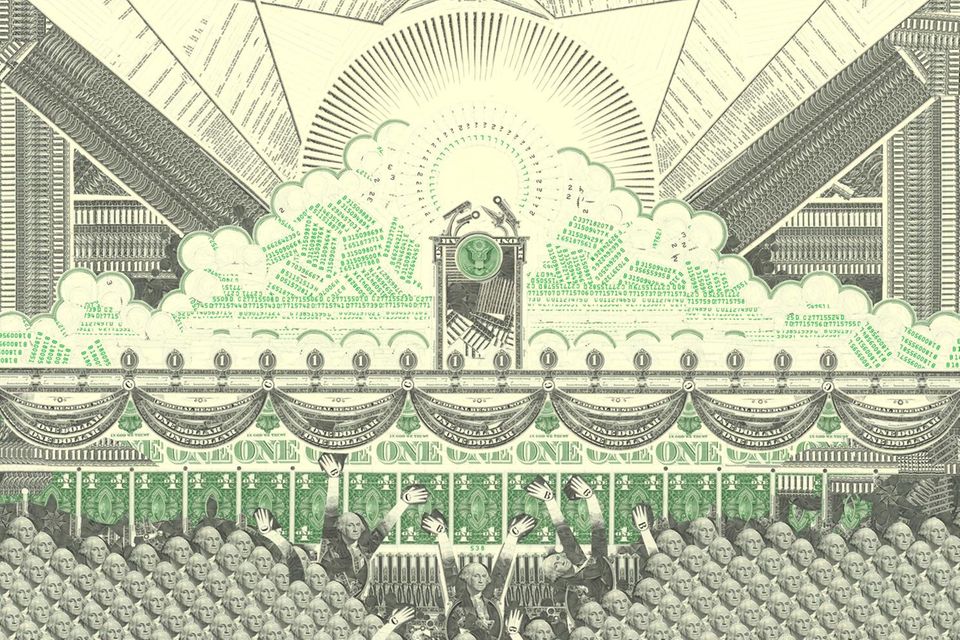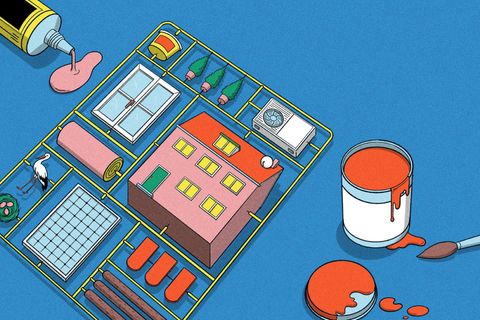Wer in deutschen Großstädten nach einer bezahlbaren Immobilie sucht, stößt häufig auf das Erbbaurecht. Stiftungen, Kommunen, Kirchen und privat Eigentümer verpachten dabei ihre Grundstücke auf Basis des Erbbaurechtsgesetzes. Für Immobilienkäufer klingt das verlockend, denn so kann ein Haus im Hamburger Süden für nur 159.000 Euro zu haben sein. Von einem solchen Fall berichtete im Sommer das „Hamburger Abendblatt“. Solche Schnäppchen haben allerdings einen Haken: Das Grundstück gehört nicht dem Käufer, sondern steht im Erbbaurecht. Bauwillige haben mit dem Erbbaurecht außerdem die Möglichkeit, ein unbebautes Grundstück zu pachten und darauf ihr eigenes Haus zu errichten.
Damit bietet das Modell einen entscheidenden Vorteil: Der Erbbaurechtsnehmer erhält das Recht, ein Haus auf einem fremden Grundstück zu bauen oder zu kaufen, ohne das Grundstück selbst erwerben zu müssen. „Das bedeutet einen erheblichen Liquiditätsvorteil, insbesondere in hochpreisigen Regionen“, erklärt Matthias Nagel, Geschäftsführer des Deutschen Erbbaurechtsverbands. „Die Grundstücksfinanzierung entfällt, was niedrigere Kredite und geringere Zinsbelastungen mit sich bringt.“
Gerade für Menschen, die sich in Städten wie Hamburg oder Frankfurt sonst kein Eigentum leisten könnten, bietet das Erbbaurecht oft die einzige Möglichkeit, in den Immobilienmarkt einzusteigen. Damit das Erbbaurecht funktioniert, zahlen Immobilienkäufer einen festgelegten jährlichen Zins, der als eine Art Nutzungsgebühr fungiert und mit einer Miete vergleichbar ist. Die Höhe dieses Zinses richtet sich nach dem Wert des Grundstücks und den Vorgaben der jeweiligen Kommune. In Frankfurt am Main beträgt der Erbbauzins für neue Verträge derzeit 2,5 Prozent des Bodenrichtwertes. In Hamburg liegt der Zins mit 1,3 Prozent etwas niedriger. Beide Städte vergeben etwa 4500 Grundstücke für Wohn- und Gewerbezwecke im Erbbaurecht.
Verträge genau prüfen
Die Verträge beim Erbbaurecht sind in der Regel zeitlich begrenzt, meist auf 60 bis 99 Jahre. Läuft der Vertrag aus, steht dem Erbbaurechtsnehmer üblicherweise eine Entschädigung für das Gebäude zu, welches er auf dem Grundstück errichtet hat. Wie hoch diese ausfällt, ist jedoch sehr unterschiedlich geregelt. „Manche Verträge sehen eine 100-prozentige Entschädigung des Gebäudewerts vor, andere gar keine“, sagt Matthias Nagel.
Käufer sollten die Vertragskonditionen daher sorgfältig prüfen und sich bei Unsicherheiten fachlichen Rat einholen. „Manchen Menschen wird erst nach Abschluss klar, dass bestimmte Regelungen wirtschaftlich oder rechtlich nachteilig sind“, erklärt Nagel. Denn es können Klauseln versteckt sein, die später zu Problemen führen.
Ein besonders wichtiger Punkt ist die Wertsicherungsklausel. Diese legt fest, wie der Erbbauzins an die wirtschaftliche Entwicklung angepasst wird. Ebenso relevant sind die Heimfallregelungen, die ein vorzeitiges Ende des Vertrags ermöglichen können – oft ohne angemessene Entschädigung für den Erbbaurechtsnehmer. Käufer sollten daher von Anfang an auf solche Details achten, um böse Überraschungen zu vermeiden.
Hausverkauf bei kurzer Laufzeit schwierig
Trotz seiner Vorteile gibt es auch zahlreiche Fallstricke. So stellt das Erbbaurecht Immobilienbesitzer beim Wiederverkauf vor Herausforderungen. Zwar ist ein Verkauf der Immobilie grundsätzlich möglich, wenn sich Käufer finden. Entscheidend dafür sind die Restlaufzeit des Vertrags und die Höhe des Erbbauzinses. „Ein Erbbaurecht mit 30 Jahren Restlaufzeit und einem günstigen beziehungsweise marktfähigen Zins ist durchaus attraktiv“, sagt Experte Nagel. Schrumpft die verbleibende Laufzeit jedoch auf nur wenige Jahre, sinken die Chancen auf einen Käufer deutlich. Hier kann eine frühzeitige Vertragsverlängerung für mehr Planungssicherheit und bessere Verkaufschancen sorgen.
Das Erbbaurecht birgt auch weitere Herausforderungen bei der Finanzierung. Zwar entfällt der Grundstückskauf, doch die regelmäßigen Erbbauzinszahlungen müssen Käufer in die Finanzierung einplanen. „Ob das wirtschaftlich sinnvoll ist, hängt unter anderem auch von der Nutzungsdauer ab“, erklärt Nagel. Bei einer durchschnittlichen statistischen Haltedauer von 16 bis 18 Jahren einer Immobilie bleibt das Modell oft attraktiv. Bei einer Nutzung über Generationen können die fortlaufenden Zahlungen jedoch zum wirtschaftlichen Nachteil werden.
Ein weiteres Risiko besteht darin, dass nicht jede Bank Erfahrung mit dem Erbbaurecht hat und diese Immobilien häufig anders eingestuft als Volleigentum. Das kann zu höheren Zinsen führen. Das liegt daran, dass Banken das Erbbaurecht oft als weniger werthaltig einschätzen, da das Grundstück nicht zum Eigentum gehört.
Grundsteuer auch ohne Grundstück
Auch die Grundsteuerreform 2025 betrifft Erbbaurechtsnehmer. „Da das Erbbaurecht ein grundstücksgleiches Recht ist, bleibt der Erbbaurechtsnehmer grundsteuerpflichtig für die Immobilie“, erklärt Nagel. Die konkreten Auswirkungen hängen von der individuellen Berechnung der Grundsteuer und regionalen Faktoren ab.