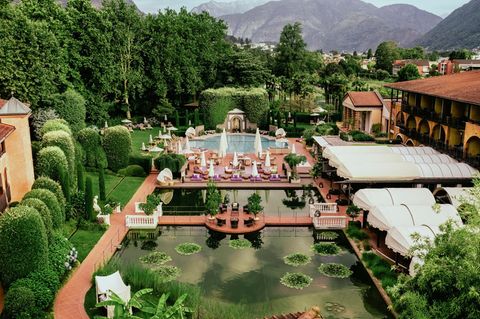Mit einer überraschenden Zinssenkung startet die Schweizer Nationalbank (SNB) einen Abwertungswettlauf und reagiert damit auf schwächere Wachstumsaussichten. Ihr erklärtes Ziel ist es, die Wirtschaft der Alpenrepublik über eine Abwertung des Franken gegenüber der Eurozone und dem Dollar-Raum wettbewerbsfähiger zu machen. Spielraum dafür gibt ihr der Rückgang der Inflation.
Die SNB überraschte mit einer geldpolitischen Wende und senkte als erste Industrieländer-Notenbank wieder ihre Zinsen nach der Post-Corona-Inflationswelle. Während die überwiegende Mehrheit der von Reuters befragten Volkswirte unveränderte Leitzinsen in der Schweiz erwartete, senkte die SNB am Donnerstag ihren Leitzins um 0,25 Basispunkte auf 1,50 Prozent. „Die Lockerung der Geldpolitik wurde möglich, weil die Bekämpfung der Inflation über die letzten zweieinhalb Jahre wirksam war“, erklärte die Notenbank. „Die Teuerung liegt nun seit einigen Monaten wieder unter zwei Prozent und somit im Bereich, den die Nationalbank mit Preisstabilität gleichsetzt.“
Niedrigere Inflationsprognose
Der Druck auf die Notenbank, sich der Inflation entgegenzustemmen, hat zuletzt kontinuierlich abgenommen: Die Schweizer Jahresteuerung ist eine der niedrigsten unter den großen Volkswirtschaften und liegt bereits seit Mitte 2023 wieder im Zielbereich der SNB von null bis zwei Prozent. „Letztendlich ausschlaggebend für die Leitzinssenkung dürfte der überraschende Rückgang der Teuerung zu Jahresbeginn gewesen sein. Ausgehend von 1,7 Prozent im Dezember sank die Inflationsrate auf 1,3 Prozent im Januar und 1,2 Prozent im Februar“, sagte Daniel Hartmann, Chefvolkswirt der Fondsgesellschaft Bantleon.
Die Zentralbank hat die für ihre Zinsentscheidung maßgeblich Inflationsprognose nochmals kräftig gesenkt: Sie rechnet dieses Jahr nun mit 1,4 Prozent, nachdem sie im Dezember noch 1,9 Prozent veranschlagt hatte. 2025 dürften die Verbraucherpreise dann um 1,2 (bislang: 1,6) Prozent steigen und 2026 um 1,1 Prozent.
Abschwächung des Franken
Volkswirte werteten die Zinssenkung zum einen als Reaktion auf nachlassenden Inflationsdruck. Zugleich schwächt dies aber den Schweizer Franken und verschafft der Wirtschaft der Alpenrepublik einen Wettbewerbsvorteil. „Der Schweizer Franken hat zwar im ersten Quartal leicht abgewertet, neigt aber schon seit längerer Zeit zu realer und nominaler Aufwertung“, sagte Rentenmarktanalyst Philipp Burckhardt von Lombard Odier „Auf der einen Seite führt dies zwar zu tieferer importierter Inflation, hemmt aber gleichzeitig auch das Wachstum. Insofern war die Zinssenkung die logische Konsequenz.“ Die SNB geht dieses Jahr von einer Verlangsamung beim Wirtschaftswachstum auf rund 1,0 (bislang: 0,5 bis 1,0) Prozent aus. 2023 war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) einer ersten Schätzung zufolge noch um 1,3 Prozent gestiegen.
Die Zinssenkung kam auch deshalb überraschend, weil für die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) als den beiden weltweit wichtigsten Notenbanken frühstens im Juni mit einer Lockerung der Geldpolitik erwartet wird.
Die Bank of Japan kündigte diese Tage sogar eine Straffung ihrer Geldpolitik an. Das ist insofern bemerkenswert, als dass der Yen am Kapitalmarkt neben dem Schweizer Franken einen Status als sicherer Hafen hat. „Wir glauben, dass die SNB in den letzten Monaten eine neutralere Haltung in der Währungspolitik eingenommen hat, anstatt aktiv eine schwächere Währung anzustreben“, sagte Dominic Bunning, Leiter des europäischen Währungsresearch bei HSBC. „Diese Haltung könnte in den kommenden Monaten in Frage gestellt werden, da der Franken nun real schwächer wird.“