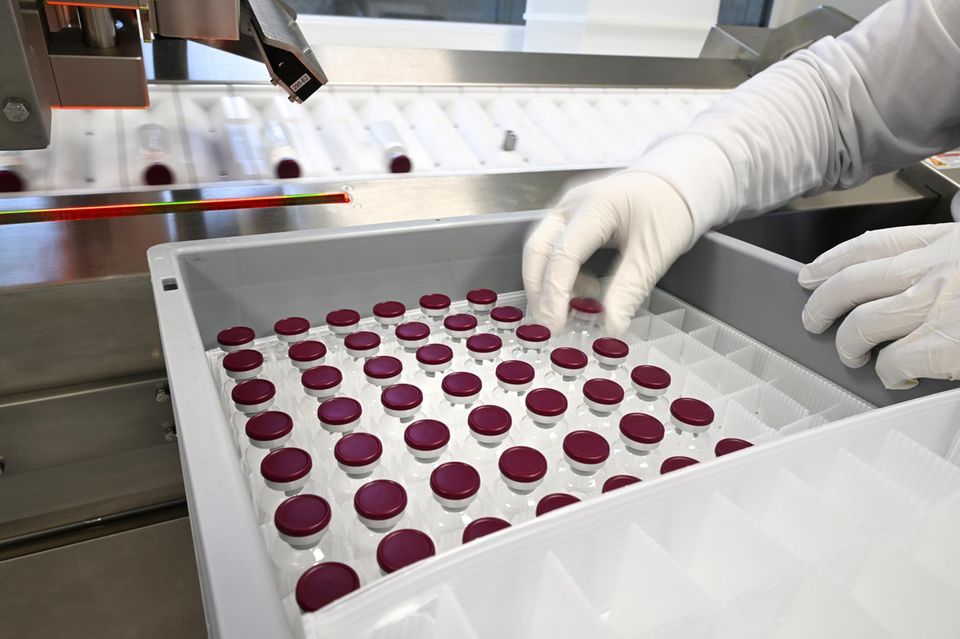Herr Karras, bisher musste man zum Notar gehen, um wichtige Verträge beurkunden zu lassen. Nun will die Bundesnotarkammer viele Dienste auch per Videokonferenz anbieten. Kann ich demnächst den Immobilienkauf oder den Ehevertrag online unterzeichnen?
BENJAMIN KARRAS: Das wird vorerst nicht gehen, und das ist auch gut so. Denn bei so relevanten Rechtsgeschäften sind die Leute gern persönlich vor Ort: Für Immobilienübertragungen, Testamente, Scheidungsfolgenvereinbarungen oder Eheverträge gehen die Leute lieber zum Notar, als sie digital am eigenen Schreibtisch abzuwickeln. Anders sieht es im Unternehmens- und Gesellschaftsrecht aus: Wenn es um Änderungen im Handelsregister geht, um Unternehmensgründungen, Kapitalerhöhungen, einstimmige Satzungsänderungen oder um die Eintragung ins Vereinsregister, dann müssen die Leute nicht mehr zwingend persönlich beim Notar erscheinen, wenn sie das nicht wollen. Solche Prozesse aus der analogen Welt übertragen wir seit zwei Jahren in die digitale Welt. Und wir sehen als Notarschaft, dass das stark angenommen wird. Vor allem von den Digital First Millennials, die gern alles online machen.
War die Online-Beurkundung ein Effekt der Corona-Pandemie?
Nicht unmittelbar, sie war bereits vorher in der Pipeline. Den Anstoß gab eine EU-Richtlinie von 2019: Die EU will die Unternehmensgründung erleichtern und hat dazu Online-Verfahren ermöglicht. Das war der Katalysator. Weil die Bundesnotarkammer sehr technikaffin ist, hat sie im August 2022 ein System zur Videobeurkundung eingeführt. Die Entwicklung war recht komplex, denn man muss ja sicherstellen, dass die eingeblendete Person tatsächlich diejenige ist, für die sie sich ausgibt. Die Identifikation der Beteiligten muss also zweifelsfrei möglich sein. Und die Vertraulichkeit des Prozesses muss gewährleistet sein.
Wie funktioniert das denn praktisch?
Die Identifikation erfolgt über den elektronischen Personalausweis und die Signatur erfolgt mittels PIN, also mittels dazugehöriger Geheimnummer.
… stimmt, den Online-Ausweis besitzen schon sehr viele, aber die meisten von uns haben ihn noch nie benutzt und wissen ihre PIN nicht einmal.
Das ist genau das Problem: Alle ab 2021 ausgestellten Personalausweise haben eine Online-Funktion und das Lichtbild kann digital ausgelesen werden. Aber man muss zum Onlineverfahren angemeldet sein, erst dann bekommt man die PIN geschickt. Und fast alle Menschen haben den Ausweis abgeholt und den Begleitbrief mit dem Anmeldeverfahren weggeworfen. Oder den Brief mit der PIN-Nummer irgendwo abgelegt. Aber man kann eine Rücksetz-PIN beantragen, bis Januar 2024 ging das voll elektronisch.
Seitdem nicht mehr?
Nein, das ist eine reichlich absurde Folge des Verfassungsgerichtsurteils zum Haushalt der Bundesregierung: Die Versendung jedes PIN-Briefs kostet den Bund umgerechnet 14,30 Euro, ist also ziemlich teuer. Deshalb müssen die Bürger jetzt persönlich im Bürgeramt erscheinen und ihre neue PIN dort abholen. Das dürfte zwar noch teurer sein, weil sich die Behördenmitarbeiter persönlich darum kümmern müssen – aber das zahlen ja die Kommunen und nicht der Bund. So viel zum Stand der Digitalisierung in Deutschland.
Wie garantiert man Vertraulichkeit in einer Videokonferenz, es kann ja hinterm Bildschirm immer noch jemand zuhören?
Die Vertraulichkeit stellen Notare nach Ermessen sicher, teilweise sollen die Beteiligten das Handy einmal im Kreis drehen oder den Bildschirm schwenken, damit sicher ist, dass sich sonst niemand im Raum befindet. Eine absolute Kontrolle ermöglicht das aber letztlich nicht, es kann ja immer irgendwo ein Mikro im Raum sein. Daher ist es immer Abwägungssache: Inwiefern nutzt man die Technik – und wo hält man sich lieber zurück?
Ist das auch der Grund, weswegen private Rechtsgeschäfte bisher nicht online abgewickelt werden?
Dafür sprechen eher menschliche Gründe: In Online-Konferenzen schaltet man ja auch innerlich schneller mal ab. Immobilien- oder Eheverträge und Testamente sind für viele Menschen einfach eine einmalige und große Sache im Leben, deshalb verleihen sie dem Prozess gern mehr Wichtigkeit, indem sie zum Notar gehen, statt so etwas zuhause in Jogginghose zu unterzeichnen. Auch ich als Notarvertreter habe die Leute dabei lieber vor mir: Wenn sich plötzlich jemand verspannt und mit den Füßen scharrt oder mit den Zähnen knirscht, sehe ich das und frage, ob es noch Klärungsbedarf gibt. Hat er Zweifel? Oder ist er mit einem Punkt nicht einverstanden? So etwas klärt sich besser in Präsenz. Es menschelt eben doch sehr beim Notar, wir sind nicht nur ein technischer Beruf.
Dennoch überlegt die Notarbranche, wo die Künstliche Intelligenz (KI) sie unterstützen kann.
Ja, weil es einen großen Fachkräftemangel auch bei uns Notaren gibt. Beim Auslesen von Grundbuchdaten zum Beispiel könnte uns die KI enorm helfen: Da müssen bisher viele Daten ausgewertet und händisch abgetippt werden. So etwas könnte die KI schneller übernehmen. Die Datenprüfung bliebe natürlich trotzdem in der Hand der Mitarbeiter. Auch bei der Geldwäscheprävention könnte eine KI womöglich schneller die Kontrollstrukturen von Unternehmen erfassen, Gesellschafter-Organigramme erstellen und so die wirtschaftlich Berechtigten ermitteln. Wir gehen davon aus, dass es für so etwas bald marktgängige Lösungen geben wird, eher in einem Jahr als in fünf Jahren.
Und wo kann Ihnen die KI nicht helfen?
Bei Vertragsentwürfen zum Beispiel. Darauf hatten viele gehofft, aber Forschungsprojekte zeigen: Man kann fünfmal exakt dieselben Informationen in eine KI füttern, dabei kommen fünf verschiedene Vertragsvorschläge heraus. Das ist für uns keine Ersparnis. Das Ausarbeiten von Verträgen hat auch viel mit den persönlichen Wünschen der Beteiligten zu tun, mit Aufklärung und mit Vertrauen. Beides wird absehbar eine menschliche Aufgabe bleiben.