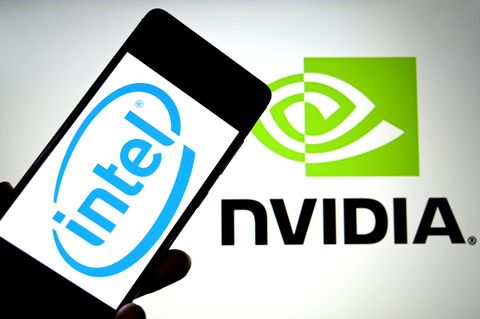Ist das Projekt nur aufgeschoben – oder endgültig am Ende?
Offiziell verkündete Intel-Chef Pat Gelsinger, die Pläne für die Fabriken in Deutschland und Polen würden für „ungefähr zwei Jahre“ ausgesetzt. Allerdings ist angesichts der Lage des Unternehmens und der Entwicklungszyklen der Branche sehr fraglich, ob es danach weitergeht. Intel hat eine Fabrik in Irland, die nach eigenen Angaben für „die absehbare Zukunft“ die Rolle eines zentralen europäischen Standorts einnehmen soll.
Und das Unternehmen verfolgt einen sehr ehrgeizigen Sparkurs, mit dem konzernweit 15.000 Arbeitsplätze abgebaut werden sollen. Es dürfte im amerikanischen Heimatmarkt schwer zu vermitteln sein, warum in Europa neue Kapazitäten aufgebaut werden, wenn gleichzeitig zuhause Jobs wegfallen. Zudem sind die Mittel für Investitionen angesichts schwacher Verkäufe und knapper Budgets bei Intel begrenzt. Trotz der Aussicht auf hohe Subventionen in Europa könnte sich das Unternehmen dafür entscheiden, die verbleibenden gut 20 Mrd. Euro für andere Zwecke einzusetzen – oder gleich ganz einzusparen.
In Polen, wo ein geplanter Standort in der Nähe der Stadt Wroclaw auf Eis gelegt wurde, wurde die Entscheidung des Intel-Konzerns fast schon wie ein Abschied aufgenommen. Der zuständige Digitalisierungsminister Krzysztof Gawkowski verzichtete auf eine Pressemitteilung und verkündete den Schritt lediglich im Kurznachrichtendienst X. Man habe mit Hilfe des Projekts Erfahrungen im Umgang mit der Europäischen Kommission gesammelt, so der Minister. „Das erlaubt es uns, ähnliche Projekte effektiv voranzutreiben.“
Wie schlecht laufen die Geschäfte bei Intel?
Der US-Konzern, einst der größte Halbleiterhersteller der Welt, zeichnete sich lange auch durch die Fähigkeit aus, Chips sowohl designen als auch selbst fertigen zu können. Allerdings hat sich der mangelnde Fokus in den vergangenen Jahren zu einem Nachteil entwickelt. Auf beiden Gebieten ist Intel stark ins Hintertreffen geraten. Beim Chip-Design haben der kalifornische Konkurrent Nvidia und die britische Arm Holding den Amerikanern in den neuen Produktgenerationen den Rang abgelaufen. Und bei der Fertigung haben sich der taiwanesische Gigant TSMC und der koreanische Samsung-Konzern etabliert.
Bei Intel führte das zu ernsthaften Problemen. Im Jahr 2023 fuhr die Fertigungssparte einen Verlust von 7 Mrd. Dollar ein. Zwar liegt das auch an Investitionen in neue Werke in den USA, aber die dürften dem Unternehmen – wenn überhaupt – erst in einigen Jahren weiterhelfen.
Beim Chipdesign leidet Intel darunter, dass es den Anschluss bei der Ausrüstung für Anwendungen in der Künstlichen Intelligenz verloren hat, ein Gebiet, auf dem Nvidia der Vorreiter ist. Das Geschäft wird in diesem Bereich vor allem mit den großen Datenzentren gemacht – und hier liegt Nvidia mit seinen Graphikprozessoren weit vorne. Die schwache Entwicklung bei Intel spiegelt sich auf dem Aktienmarkt: Während sich der Kurs von Nvidia im Verlauf der letzten zwölf Monate mehr als verdoppelt hat, hat sich der Wert bei Intel halbiert.
Welche Ziele verfolgt Intel-Chef Gelsinger mit seinem Restrukturierungsplan?
Der Intel-Chef setzt in seinem Restrukturierungsplan auf drei Säulen: Erstens sollen die Bereiche Chipfertigung und Chipdesign noch stärker voneinander getrennt werden, um den Konkurrenzkampf in den jeweiligen Märkten besser aufnehmen zu können. „Intel Foundry“ wird künftig als eigenständige Untereinheit für die Fertigung innerhalb des Unternehmens geführt.
Zweitens will Gelsinger sparen, indem er Arbeitsplätze streicht und „zwei Drittel“ der Immobilien abstößt, die der Konzern an weltweiten Standorten noch hält.
Und drittens, das ist die Zukunftskomponente, soll der auf Künstliche Intelligenz ausgelegte Fertigungsprozess „18A“ konkurrenzfähige Produkte hervorbringen, für die Intel auch schon mögliche Abnehmer hat: Microsoft ist ebenso darunter wie der Amazon-Konzern, der sich weniger abhängig vom Marktführer Nvidia machen möchte.
„Wir haben eine Menge Arbeit vor uns, wenn wir effizienter werden, unsere Profitabilität steigern und eine größere Wettbewerbsfähigkeit erreichen wollen“, sagte Gelsinger im Brief an seine Mitarbeiter. Die große Frage allerdings ist, ob weitere europäische Standorte wie in Magdeburg oder Wroclaw Teil dieses Plans sein werden oder innerhalb des Intel-Konzerns eher als Klotz am Bein betrachtet werden.
Welche Folgen hat die Entscheidung für den Standort in Magdeburg?
Am Magdeburger Eulenberg wollte Intel zwei Fabriken bauen, in denen 3000 Menschen Arbeit finden sollten. Die Baugenehmigung für die ersten Hallen war erst Anfang September erteilt worden. Ursprünglich war der Baustart des 2022 angekündigten Projekts schon für die erste Jahreshälfte 2023 vorgesehen, dann aber auf Ende 2024 verschoben worden.
Bislang wurde in dem geplanten High-Tech-Park nur am Ausbau einer Zufahrtstraße gearbeitet. In dem Gewerbepark waren 400 Hektar für Intel vorgesehen, weitere 700 Hektar für Zulieferer. Für 90 Prozent der Flächen gebe es bereits Vorverträge, sagte Frank Ribbe, Geschäftsführer des High-Tech-Parks, im August dem MDR. Wie viele davon auch ohne ein Intel-Werk sich ansiedeln würden, ist nun die große Frage.
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff zeigte sich vor wenigen Wochen noch überzeugt, im Fall eines Intel-Baustopps für die Flächen problemlos andere Abnehmer auftun zu können. „Einen Plan B brauchen wir nicht“, sagte Haseloff. „So ein Filetstück würden auch Unternehmen aus anderen Branchen nirgendwo anders finden.“
Viel mehr als Zweckoptimismus dürfte das nicht sein – im aktuell dürftigen Investitionsklima dürfte es der Landesregierung einigermaßen schwer fallen, eine vergleichbare Ansiedlung an Land zu ziehen.
Realistischer war am Dienstag dann auch die Aussage von Haseloffs Wirtschaftsminister Sven Schulze im „Handelsblatt“, die Verschiebung habe „natürlich Auswirkungen auf unsere Planungen für Abwasseranlagen, Zufahrtsstraßen, Infrastruktur und so weiter“. Dafür seien nun Gespräche mit Intel vereinbart. Er glaube aber weiterhin an eine Realisierung der Chipfabriken: „Intel hält, wenn auch mit einer zeitlichen Verzögerung, weiter an dem Projekt fest“, so Schulze zur Deutschen Presse-Agentur.
In der strukturschwachen Region hatte das Intel-Vorhaben eine seltene Aufbruchstimmung ausgelöst. Diese dürfte vorerst zum Erliegen kommen.
Was plant die Bundesregierung mit den 10 Mrd. Euro Subventionen?
Gut ein Drittel der 30 Mrd. umfassenden Investitionssumme sollten Fördermittel der Bundesregierung sein. Über die Verwendung der nun frei gewordenen Mittel entbrannte schon am Montagabend koalitionsinterner Streit.
Finanzminister Christian Lindner (FDP) betonte, die Gelder müssten „zur Reduzierung offener Finanzfragen im Bundeshaushalt reserviert werden“. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) warnte hingegen vor einer derartigen Vorfestlegung: „Wir haben Gelder vorgesehen, die auch weiter benötigt werden für unsere Halbleiterprojekte und jetzt gibt es keinen Anlass, von einem Tag auf den anderen zu sagen, wie wir damit einzeln umgehen.“ Und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) forderte zunächst interne Beratungen innerhalb der Koalition: „Wie jetzt konkret mit den reservierten Geldern zu verfahren ist, das werden wir hinter den Kulissen in der Regierung besprechen.“
Klar ist: Für 2024 waren zunächst nur vier der etwa zehn Milliarden für Intel vorgesehen. Weil das Geld bereits im Klima- und Transformationsfonds hinterlegt sei, könne es auch nicht für den Kernhaushalt verwendet werden, so das Bundeswirtschaftsministerium. Die Debatte über den Einsatz der Milliarden dürfte die Koalition aber weiter beschäftigen.
Was heißt das Intel-Aus für die Chip-Strategie von EU und Bundesregierung?
Im Wettlauf um die Dominanz im Chipmarkt setzen China, die USA und Europa seit einiger Zeit auf massive Subventionen. Die EU verabschiedete 2023 den Chips Act, auch die Bundesregierung versucht mithilfe von milliardenschweren Fördertöpfen, die Ansiedlung von Halbleiterunternehmen zu befördern. Das große Ziel: bei der Chipproduktion unabhängiger zu werden.
Laut einer Aufstellung von Germany Trade and Invest waren für Deutschland bislang Investitionen über 50 Mrd. Euro angekündigt worden – alleine 30 davon bezogen sich aber auf das Intel-Werk in Magdeburg. Andere Vorhaben wurden ebenfalls verschoben oder stehen in Frage (siehe unten).
Habeck betonte am Dienstag dennoch, am Ziel, eine Halbleiterproduktion in Europa halten beziehungsweise aufbauen zu wollen, ändere sich nichts. „Denn die Strategie ist ja nicht auf ein einziges Unternehmen ausgerichtet, sondern darauf, dass wir Wirtschaftssicherheit bekommen, dass wir in diesem kritischen Industriebereich eine gewisse Kompetenz auch in Europa haben und nicht zu 100 Prozent abhängig sind von südostasiatischen Märkten.“
Unter Experten galt das Vorhaben aber immer schon als mindestens ambitioniert. Es stelle sich die Frage, „ob man mit solchen Subventionen wirklich eine geostrategische Unabhängigkeit erreichen kann“, sagt etwa der Ökonom Reint Gropp vom IWH Halle. Auch mit einer funktionierenden Chipfabrik in Magdeburg müssten etwa „immer noch sehr viele Vorprodukte aus China und Taiwan eingeführt werden“. Es sei quasi „unmöglich, die gesamte Lieferkette für Chips nach Europa oder sogar nach Deutschland zu verlagern“. Unterm Strich verlagere man „die geostrategische Abhängigkeit von einer Ebene auf eine andere“.
Wie steht es um die anderen großen Chip-Projekte?
Das Bild ist bestenfalls gemischt. Zwar konnte die deutsche und europäische Spitzenpolitik im August den Spatenstich für ein Werk des taiwanesischen Chipfertigers TSMC in Dresden feiern – hier werden gemeinsam mit Bosch, Infineon und NXP Halbleiter vor allem für die Autobranche gefertigt werden. 2027 soll die Produktion in dem Werk beginnen, 2000 Arbeitsplätze stehen in Aussicht. 5 Mrd. Euro investieren die beteiligten Unternehmen, weiter 5 Mrd. Euro kommen vom Staat.

Novo Nordisk, Lundbeck und Orifarm: Wachstumstreiber für Ihr Portfolio?
Andere Leuchtturmprojekte verzögern sich jedoch. Beim US-Unternehmen Wolfspeed, das gemeinsam mit dem Autozulieferer ZF im saarländischen Ensdorf sogenannte Leistungshalbleiter aus Siliziumkarbid produzieren wollte, leidet man ebenfalls unter schwach laufendem Geschäft. Daher übte zuletzt unter anderem der aktivistische Investor Jana Partners Druck auf die Unternehmensführung aus, bestimmte Investitionsprojekte zu überdenken. Laut Reuters soll dazu auch das Projekt im Saarland zählen.
Anfang 2023 war die Investition angekündigt, der Bau sollte sogar schon in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres beginnen – doch daraus wurde nichts. Nun sollen die Bagger frühestens 2025 rollen. Ende Juni wurde in Ensdorf immerhin schon einmal das dort bislang stehende Kohlekraftwerk gesprengt, nun läuft der Rückbau. Für den Bau der Fabrik steht bislang eine Investitionssumme von 2,7 Mrd. Euro im Raum, von der 700 Mio. Euro Staatsmittel wären. Produktionsbeginn soll 2027 sein, hunderte Jobs dürften entstehen.
Ebenfalls in Dresden will der deutsche Halbleiterspezialist Infineon 5 Mrd. Euro in eine Werkserweiterung stecken und damit 1000 neue Arbeitsplätze schaffen. 1 Mrd. Euro davon sollen Subventionen sein. Laut Vorstandschef Jochen Hanebeck liegt das Projekt „voll im Zeitplan“. In der „Süddeutschen Zeitung“ kündigte Hanebeck vor einigen Wochen an, dass in einem Jahr die Maschinen ankommen dürften und die Produktion dann 2026 starten soll. Der Spatenstich für das Projekt fand bereits 2023 statt. Allerdings kämpft auch Infineon mit einem Gewinneinbruch und hat einen Sparkurs eingeleitet; in Europa werden derzeit 2800 Stellen abgebaut.