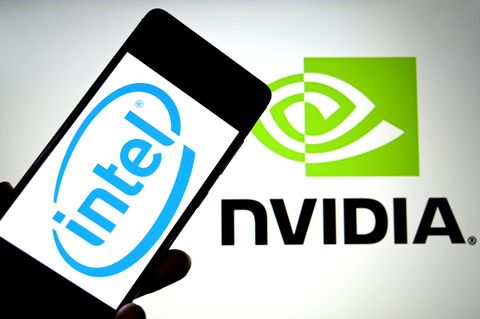Man kann es sich jetzt sehr einfach machen, so, wie es die AfD und erste Stimmen aus der Union bereits tun: Seht her, so weit ist es gekommen mit dem Standort Deutschland – nicht mal 10 Mrd. Euro Subventionen vom Staat reichen aus, um einem Weltkonzern aus den USA eine Fabrik in Deutschland schmackhaft zu machen. Das laute Wehklagen, immer auch etwas inszeniert, schwillt schnell an. Es wird die Grundmelodie sein in diesem aufziehenden Herbst.
Tatsächlich ist die Nachricht des Chipkonzerns Intel, den geplanten Bau von zwei Chipfabriken in Magdeburg um mindestens zwei Jahre aufzuschieben, ein herber Rückschlag. Für die europäische Wirtschaft, für Ostdeutschland und die Region Magdeburg und ebenso für die Bundesregierung in Berlin. Nur: Als weiteres Beispiel für den Niedergang des Standortes, für fehlende Wettbewerbsfähigkeit und große strukturelle Nachteile taugt diese Entscheidung nicht. Wer wirklich verstehen will, was bei diesem Mega-Projekt schiefgelaufen ist, muss genauer hinschauen.
Intel steht für die Vergangenheit der Tech-Industrie
Da ist zum einen die Lage von Intel, ein Gigant der US-Industrie, der allerdings schon seit einigen Jahren mit großen Problemen kämpft. Das Logo „Intel inside“ klebte in den 1990er und 2000er Jahren auf fast allen Rechnergehäusen – und genau da beginnt schon das Problem. Intel steht mit seinen Chips für die Vergangenheit der Tech-Industrie, die ganz modernen Prozessoren bauen heute andere: TSMC aus Taiwan, Samsung und SK Hynix aus Südkorea, Micron, AMD und Broadcom aus den USA etwa. Und natürlich, allen voran: Nvidia, das mit seinen Chips das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz eröffnet hat.
Intel dagegen steht für jene Chips, die zwar in fast allen Produkten mit einem Stromkabel stecken, die aber in der Halbleiterbranche heute ungefähr so angesehen sind wie Sand in der Bauindustrie: Braucht man auch, aber das große Geschäft wird eher woanders gemacht.
Es war dieses ungute Gefühl, dass das Projekt bei Magdeburg von Anfang an begleitete: Eine heimische Chipproduktion ist richtig und wichtig, solche Fabriken sind immer gewaltig und immens teuer – aber musste es wirklich Intel sein? Sind das die Chips, von denen die Zukunft der deutschen und der europäischen Wirtschaft abhängt? Die Antwort der meisten Experten lautete schon vor zwei oder drei Jahren: Eher nein. Die Absatzkrise des Konzerns und der Preisverfall bei diesen Chips, die den Konzern nun zu einem rigiden Sparkurs zwingen, waren da schon absehbar.
Gelsingers Verzweiflungstat
Die Strategie von Intel-Boss Pat Gelsinger, auf der ganzen Welt neue Fabriken zu bauen und ein gigantisches Investitionsprogramm aufzulegen, entstammte weniger dem ehrgeizigen Versuch, den Chipmarkt neu zu erobern. Es war vielmehr eine Verzweiflungstat, um einem siechen Konzern eine neue Daseinsberechtigung zu verschaffen – und sehr viel staatliches Geld. Denn nicht nur in Deutschland, auch in Polen, Italien, Irland und selbst im Heimatland USA sammelte Gelsinger milliardenschwere Förderbescheide der Regierungen ein. Wenn schon nicht aus eigener Kraft und dank innovativer Produkte, so doch wenigstens mit staatlicher Unterstützung sollte Intel eine Zukunft erhalten.
Alle, die Gelsinger auf diesem Weg großzügig unterstützten, hätten gewarnt sein müssen: Die Börse hat diese Strategie nie geglaubt.
Was zur Rolle der Politik, in Deutschland besonders der Bundesregierung führt: Es war richtig, nach den Erfahrungen der Corona-Pandemie daran zu arbeiten, in Europa wieder eine eigene Chipfertigung aufzubauen. Die Globalisierung der Lieferketten hat in der Pandemie einen schweren Knacks erlitten, und sie wird sich so schnell auch nicht wieder normalisieren. Denn neben den notorischen Handelskonflikten und der großen Blockrivalität zwischen China und den USA lastet auf der Chipindustrie zusätzlich ein drohender Krieg zwischen China und Taiwan. Überfällt China Taiwan, könnte die dortige Chipproduktion kollabieren, was eine weltweite Wirtschaftskrise zur Folge hätte. Sich von diesem Risiko zumindest etwas zu befreien, war und ist richtig.
Und zur Wahrheit gehört auch, dass sich, ausgehend von den USA, in dieser Industrie ein Subventionswettlauf etabliert hat, von dem sich keine Regierung befreien kann. Das ist ordnungspolitisch grundfalsch, aber allein mit noch so guten Standortbedingungen und noch so sauberen Prinzipien der freien Marktwirtschaft wäre kein Chiphersteller der Welt darauf gekommen, ausgerechnet in Deutschland eine Fertigung aufzubauen. Das galt übrigens auch schon in den 90er-Jahren unter Helmut Kohl, als die CDU-Landesregierung in Sachsen mit hohen Subventionen um Dresden herum Chipfabriken ansiedelte.
Immerhin, der Bund hatte nicht nur die Chipfabrik in Magdeburg im Blick, sondern weitere Werke und Hersteller in Sachsen und im Saarland – auch dort fließen etliche Milliarden an Subventionen. Doch Intel war das größte und teuerste Projekt und das schwächste von Beginn an. Hier nicht frühzeitig auf andere, stabilere Hersteller zugegangen zu sein und mögliche Alternativen zu Intel erarbeitet zu haben, ist wahrscheinlich der größte Fehler von Wirtschaftsminister Robert Habeck und Kanzler Olaf Scholz. Selbst als Finanzminister Christian Lindner laut Zweifel an der Höhe der Subventionen anmeldete, boxten Kanzleramt und Wirtschaftsministerium das Vorhaben durch.
Nur so konnte es passieren, dass ein Werk zu einem Symbol für den großen Aufbruch und die Transformation der deutschen Wirtschaft werden konnte, das dafür eigentlich von Anfang gar nicht geeignet war. Neben dem wirtschaftspolitischen Rückschlag muss sich die Ampel, in diesem Fall vor allem SPD und Grüne, dieses Kommunikationsdesaster anheften lassen.
Industrie muss unabhängiger von Taiwan und China aufgestellt werden
Der größte Verlierer bei dem vorläufigen Aus der Megafabrik (die wahrscheinlich auch in zwei Jahren nicht gebaut werden wird) aber ist die Region um Magdeburg und die ostdeutsche Wirtschaft. Mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall sollte die Megainvestition einer alten Industrieregion einen neuen, kräftigen Aufschwung verleihen. Zehntausend gut bezahlte Arbeitsplätze sollten entstehen, neue Wohngebiete, neue Kitas und neue Schulen wurden schon geplant – es war eine ganz neue Perspektive für einen Landstrich, der seit 30 Jahren eigentlich immer nur schrumpft und zurückbaut. Und in dem das einzige, was seit Jahren kontinuierlich wächst, die Zustimmung zur AfD ist.
Immerhin, um der Pleite wenigstens etwas Positives abzugewinnen, werden jetzt im Haushalt und in der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes 10 Mrd. Euro frei. Da im Haushalt für 2025 ohnehin noch große Lücken klafften, lässt sich das Geld dort gut verplanen. Allerdings: Die Aufgabe, die deutsche Industrie geopolitisch unabhängiger von Taiwan und China aufzustellen, war und ist richtig. Mit der Absage von Intel ist sie sogar umso dringlicher.