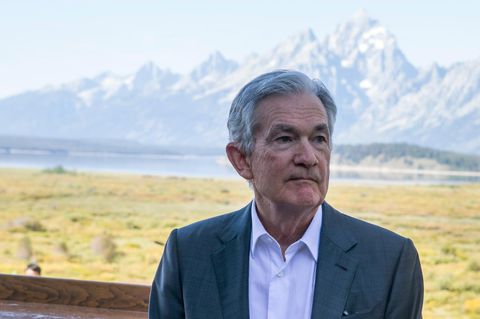Nach der Wahl ist vor der Entscheidung. In den gut drei Wochen bis zum EU-Gipfel am 20. und 21. Juni wollen Europas Spitzenpolitiker die Weichen für die personelle Zukunft stellen. Für die Finanzmärkte geht es dabei vor allem um eine Frage: Wer folgt am 1. November Mario Draghi als Präsident der Europäischen Zentralbank, der zweitgrößten Notenbank der Welt?
Die wichtigste Vorentscheidung darüber, ob Jens Weidmann sein Büro von der Bundesbank im Frankfurter Norden zur EZB ins Ostend verlagern kann , wird wohl Frankreichs Präsident Emmanuel Macron treffen. Gerade weil Berlin und andere Hauptstädte seinen Vorschlägen für eine Reform der EU und der Eurozone bisher kaum entgegen gekommen sind, werden sie ihm in Personalfragen wohl einen Erfolg gönnen. Bleibt Macron dabei, dass er das „Spitzenkandidaten“ Modell für die Nachfolge Jean-Claude Junckers ablehnt, wird es Manfred Weber von der EVP kaum gelingen, sich diesen Posten zu sichern. Sollte Macron stattdessen den angesehenen Brexit-Unterhändler Michel Barnier oder Frankreichs stellvertretende Zentralbankchefin Sylvie Goulard nach Brüssel senden können, wäre im Gegenzug der Weg frei für einen deutschen oder zumindest von Berlin unterstützen Kandidaten für Frankfurt. Weber müsste dann mit einem anderen Posten abgefunden werden, sei es als Chef des Europäischen Parlaments oder als neuer Innenminister in Berlin.
Sollten dagegen Macron und andere Liberale doch Weber als Präsidenten der Europäischen Kommission akzeptieren, würde vermutlich der französische Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau oder seine Stellvertreterin Goulard nach Frankfurt wechseln.
Wie verhält sich Salvini?
Besonders interessant könnte es werden, wenn Macron und die Liberalen sich mit Konservativen und Sozialdemokraten auf die Dänin Margrethe Vestager oder den ebenfalls liberalen belgischen Regierungschef Charles Michel für die Europäische Kommission einigen könnten. In diesem wenig wahrscheinlichen Fall stünden die Chancen für Weidmann recht gut. Es kämen dann allerdings auch Bewerber aus Paris oder Überraschungskandidaten aus anderen Ländern in Frage.
Neben Macron wird beim Postengeschacher wohl auch Italiens Rechtsausleger Matteo Salvini ein gewichtiges Wort mitreden wollen. Als Kraftzentrum der italienischen Regierung hat er durch die Europawahlen weiteren Auftrieb erhalten. Weidmann hat sich durch seine anfangs übermäßig harte Haltung in der Eurokrise in Südeuropa keine Freunde gemacht. Dass seine Argumente gegen den Kriseneinsatz der EZB sich im Nachhinein als nur wenig stichhaltig erwiesen haben, macht ihn ebenfalls angreifbar. Ob Salvini dennoch bereit sein könnte, Weidmann als Teil eines größeren Personalpakets zu akzeptieren, bleibt offen. Möglicherweise würde er im Gegenzug eine so nachsichtige Interpretation der europäischen Fiskalregeln verlangen, dass Berlin und Brüssel darauf nicht eingehen könnten.
In solch einem Fall könnte dann statt Weidmann Finnlands Olli Rehn bei der EZB zum Zuge kommen . Rehn hatte sich als europäischer Währungskommissar während der Eurokrise ein Namen als allseits geschätzter Vermittler gemacht, der bei allem Einsatz für Grundsätze im entscheidenden Moment auch den Kompromiss finden kann. Weidmann könnte hoffen, dass sich Salvini – und andere südeuropäische Vertreter – vielleicht mit einem Angebot zufriedengeben würden, das Rom wieder den Posten des EU-Außenbeauftragten übernehmen könnte.
Weidmann hat Flexibilität bewiesen
Insgesamt hat Weidmann durchaus Chancen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass er sich durchsetzen wird, aus heutiger Sicht deutlich unter 50 Prozent liegen dürfte. In Deutschland geben sich allerdings all diejenigen, die sich von Weidmann bei der EZB spürbar höhere Zinsen erwarten würden, wohl einer Illusion hin. Die Bundesbank hat sich in den vier Jahrzehnten, in denen sie für die D-Mark zuständig war, in der Praxis als viel flexibler erwiesen, als es ihrem heutigen Ruf entspricht. Die deutsche Inflation lag im Schnitt bei 2,9 Prozent statt, wie unter der EZB seit 1999, bei 1,4 Prozent. Wenn es sein musste, hat die Bundesbank auch mal Staatsanleihen gekauft und kräftig für den französischen Franc und die italienische Lira interveniert. Ihr Geldmengenziel hat die Bundesbank in nahezu der Hälfte aller Fälle verfehlt, vielfach aus guten Grund.
Als echter Bundesbanker hat auch Weidmann sich in seiner bisherigen Karriere als hinreichend flexibel erwiesen, beispielsweise als Wirtschaftsberater der Kanzlerin während der großen Finanzkrise. Eine grundlegend andere Geldpolitik würde er nicht betreiben. Selbst wenn es ihm schwerfiele, würde er vermutlich im Ernstfall seiner Verantwortung für den ganzen Euroraum gerecht werden und alle Instrumente der EZB einsetzen, um eine Neuauflage der Finanz- und Eurokrise zu vermeiden.
Zudem wäre Weidmann ja nur Primus inter Pares. Wie die meisten anderen möglichen Bewerber für die Präsidentschaft der EZB gehört er ja bereits jetzt dem 25-köpfigen Zentralbankrat an. Ob er – oder Villeroy de Galhau oder Rehn – ihre Argumente künftig vom Präsidentenstuhl oder ihrem derzeitigen Sitz vorbringen, wird die Überzeugungskraft nur bedingt erhöhen. Wie unter Draghi wird es auch künftig darauf ankommen, im Gremium vieler selbstbewusster Notenbanker unterschiedlicher Herkunft auf der Basis einer klaren Analyse Entscheidungen vorzubereiten und zu treffen, die von einer großen Mehrheit getragen werden können.
Da sich bisher kein nennenswerter Inflationsdruck abzeichnet, dürfte die EZB auch unter Weidmann die Leitzinsen noch für mindestens ein Jahr unverändert lassen. Weidmann selbst hat in den letzten Jahren bereits stärker betont als vorab, dass er mit wesentlichen Weichenstellungen der EZB übereinstimmt. Eine geldpolitische Revolution wäre in Frankfurt auch von ihm nicht zu erwarten. Vermutlich würde er als gestandener Volkswirt und Notenbanker – ebenso wie seine wichtigsten Mitbewerber – das Amt in etwa so ausfüllen, wie es die Situation erfordern würde. Sollte es tatsächlich wider Erwarten noch einmal richtig knallen in Europa mit einer neuen Mega-Krise könnte es sogar von Vorteil sein, dass dann ein deutscher Notenbankchef der deutschen Öffentlichkeit erklären müsste, weshalb die Notenbank doch erneut zu außergewöhnlichen Mitteln greifen müsste. Das könnte durchaus für Weidmann sprechen.