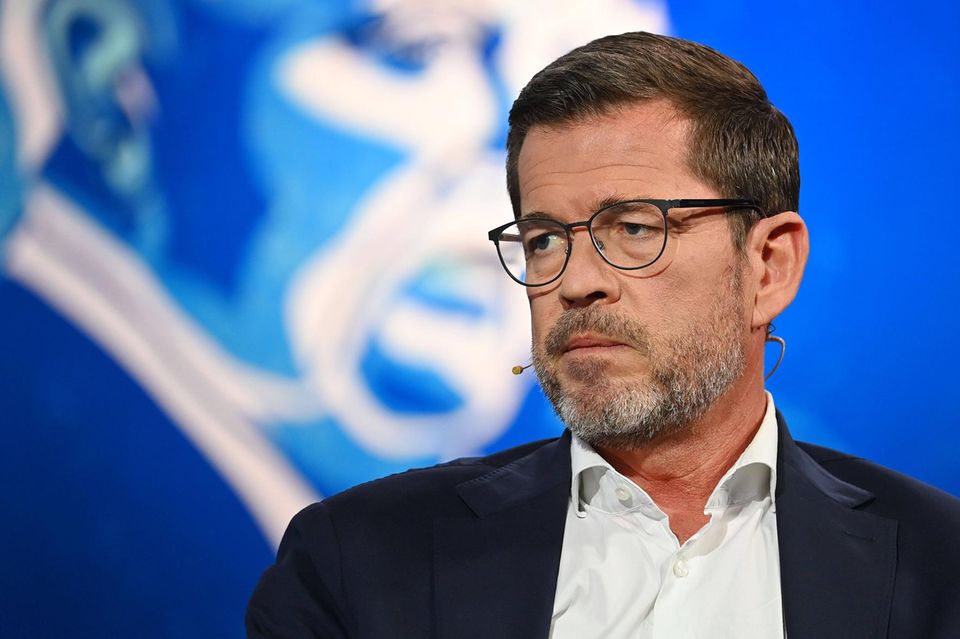In unserer Reihe Capital erklärt geben wir einen komprimierten Überblick zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Diesmal: Shared Mobility – mit Capital-Redakteur Nils Kreimeier, der für die Themen Automobilwirtschaft und Digitalisierung zuständig ist
Was fällt alles unter den Begriff Shared Mobility?
Bei Shared Mobility unterscheidet man zwischen zwei Grundformen. Entweder es handelt sich um einen Fahrdienst (Ride-Sharing), den mehrere Personen gleichzeitig nutzen. Oder es handelt sich um ein Fahrzeug, das sich mehrere Personen teilen, aber zu unterschiedlichen Zeiten nutzen. Darunter fallen dann Fahrzeuge wie Autos, E-Scooter, Tretroller oder Fahrräder.
Was ist das Geschäftsmodell dahinter?
Das Grundprinzip von Shared Mobility ist einfach: Es gibt in der Regel einen minutenbasierten Preis, der beim Auto zum Beispiel zwischen 20 und 30 Cent liegt. Das ist von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Carsharing hat das Prinzip des minutenbasierten Preises etabliert und Anbieter für Elektroroller oder Fahrräder haben es ebenfalls zu ihrer Marktstrategie gemacht. Bis jetzt verdient aber noch kein Unternehmen viel Geld damit. Nur bei den E-Scootern, die relativ neu auf dem Markt sind heißt es, dass sich damit schnell Geld verdienen lasse. Denn die Roller sind günstig im Einkauf und können schnell refinanziert werden – offizielle Zahlen gibt es dazu aber noch nicht.
Hat dieses Modell auch Perspektive auf dem Land?
Natürlich wäre es effektiver ein solches Modell in ländlichen Räumen einzuführen, weil dort der Bedarf an Mobilität viel dringender ist. Shared Mobility befindet sich aber in vielen Bereichen noch in der Startphase und ist auf möglichst viele Bewegungsdaten angewiesen, um das Konzept verbessern zu können. Das heißt, es müssen in kürzester Zeit so viele Personen wie möglich die Angebote von Shared Mobility nutzen. Im ländlichen Raum ist es fast unmöglich, eine breite Masse dafür zu finden.
Auf welche Weise profitieren die Städte davon?
Für die Parkplatznutzung der Fahrzeuge werden Rahmenverträge mit der Stadt abgeschlossen, sodass die Nutzer der Fahrzeuge kostenlos auf öffentlichen Parkplätzen parken können. Teilweise steigen die Städte sogar selbst in das Geschäft mit ein. In Berlin zum Beispiel gibt es eine Zusammenarbeit zwischen den öffentlichen Verkehrsbetrieben und Via, einem Partnerunternehmen von Daimler. Zusammen bieten sie das App-gesteuerte Sammeltaxi „BerlKönig“ an.
Welche Rolle spielt die E-Mobilität bei dem ganzen?
E-Mobilität spielt eine immer wichtigere Rolle für die Angebote von Shared Mobility. Die BMW Sharing-Tochter DriveNow begann damit, ihr erstes Elektroauto auch in die Flotte ihres Carsharing-Angebots aufzunehmen. Volkswagen hat erst jetzt mit einem Carsharing-Angebot angefangen (weShare), aber dafür sind sie mit einer 100 Prozent Elektro-Flotte eingestiegen. Das entspricht der gesamten Konzernstrategie von Volkswagen, sehr stark auf rein Batteriebetriebene Autos zu setzen.
E-Mobilität etabliert sich immer mehr, doch das Laden der Autos ist nach wie vor ein großes Problem. Anbieter wie Volkswagen haben Mitarbeiter, die die Autos für die Kunden aufladen. Denn viele Personen empfinden es als Hürde, die Autos an eine Ladesäule zu bringen und das Kabel aus dem Kofferraum an die Ladesäule zu stecken. Konzerne locken ihre Kunden mittlerweile mit Freiminuten, vorausgesetzt der Kunde lädt das Auto selbst wieder auf.
Shared Mobility wird eine fragwürdige Ökobilanz vorgeworfen. Was steckt dahinter?
Das politische Versprechen hinter Shared Mobility ist, dass der Verkehr auf den Straßen wesentlich reduziert wird, weil die Autos besser ausgelastet sind. Das heißt, das Auto steht nicht die meiste Zeit des Tages auf einem Parkplatz und wird nur für die Fahrt nach Hause genutzt, sondern es ist ein Sharing-Auto, das in der Zwischenzeit auch von anderen Personen genutzt wird. Das hätte dann auch einen positiven Effekt auf die Luftqualität und die Minderung des Schadstoff-Ausstoßes.
Ob dieses Versprechen allerdings erfüllt wird, ist bisher äußerst fraglich. In den meisten Städten steigt das Verkehrsaufkommen nach wie vor, egal, ob dort Carsharing angeboten wird oder nicht. Es gibt sogar Studien aus den USA, die besagen, dass die Zahl der Fahrzeuge im Straßenverkehr durch Shared Mobility noch mehr steigt – weil dann Fahrten auf Strecken stattfinden, die man sonst vielleicht zu Fuß oder per U-Bahn zurückgelegt hätte.
Was bedeuten diese Dienstleistungen für die Automobilbranche?
Die Automobilbranche hat das berechtige Gefühl bei der Neuformierung der Mobilität dabei sein zu müssen und nicht nur zuzusehen, wenn Unternehmen wie Uber neue Beförderungskonzepte entwickeln. Sie müssen Erfahrungen sammeln, um zu wissen, wie sich Sharing-Flotten in den Städten bewegen. Und diese Erfahrungen sind für den Anfang viel wichtiger, als die Frage, ob sie damit Geld verdienen können oder nicht.
Dazu kommt, dass die deutschen Hersteller unter Druck stehen, weil sie ihre Flottenemissionen laut EU-Vorgaben in den kommenden Jahren senken müssen. Elektroautos werden durch die EU als Null-Emissionsfahrzeuge gewertet. Deshalb ist es für Unternehmen ein doppelter Gewinn, wenn sie ein Elektroauto in ihre Sharing-Flotte aufnehmen.
Der Anreiz ist groß, die Autos so schnell wie möglich auf dem Markt zu etablieren, und das lässt sich über Carsharing gut lösen. Es muss kein Käufer von dem Auto überzeugt werden, sondern das Auto steht auf der Straße, ist registriert und gehört damit automatisch zur Sharing-Flotte des Unternehmens.
Wie wird sich der Shared Mobility Markt verändern?
Das nicht-stationsgebundene Sharing-Modell gibt es jetzt seit knapp zehn Jahren in Deutschland und in dieser Zeit hat ein starkes Wachstum stattgefunden – sowohl bei den alten Anbietern, als auch bei denen, die neu dazugekommen sind. Die Daimler-Tochter car2go startete 2009 in einem Testmodell mit 200 Autos. Heute hat das Unternehmen weltweit 14.000 Fahrzeuge und mehr als drei Millionen Kunden. In Berlin gibt es mittlerweile fünf Anbieter für nicht-stationsgebundenes Carsharing. Dazu kommen noch die stationsgebundenen und die Ride-Sharing Anbieter wie CleverShuttle und BerlKönig. Die Grenze der Anbieter für Shared Mobility ist langsam erreicht, aber die Sharing-Flotten der Unternehmen werden weiterhin ausgebaut.
Wie sich die Angebote von Shared Mobility entwickeln werden, hängt letztendlich davon ab, wie viel Umsatz in ein paar Jahren garantiert werden kann. Wenn sich das Modell nicht rechnet, wird sich der Markt wieder verkleinern.