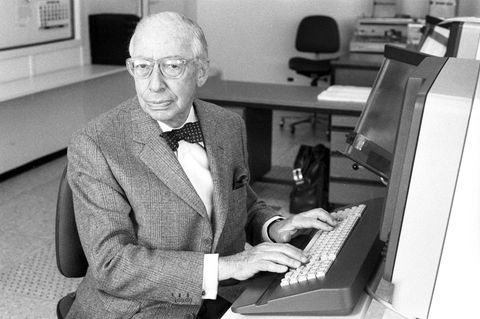Noch immer gilt Wachstum als Maxime der Wirtschaftspolitik. Je größer der Kuchen, umso mehr gibt es zu verteilen. So einfach lautet die Theorie. In den vergangenen Jahren gab es aber immer mehr Stimmen, die auf einen vermeintlichen Konzeptionsfehler hinwiesen. Sie sagen, dass der Kuchen nicht größer werden könne, denn die Erde und ihre Ressourcen seien endlich – wer den Kuchen größer mache, beraube sich also seiner Zukunft.
Um ihre Thesen zu untermauern, legten die Wissenschaftler etliche Studien vor. Eine neue wachstumskritische Bewegung entstand, genannt Degrowth, die für Verzicht statt Wachstum plädierte. Bekannte Stimmen der Bewegung wie Niko Paech oder Tim Jackson kritisieren den Kapitalismus, übermäßigen Konsum und das Wirtschaftswachstum als Wohlstandsindikator. Sie wollen ein Weniger von allem: weniger Produktion, weniger Verbrauch, weniger Wirtschaftsleistung. So ließen sich ihrer Ansicht nach Probleme wie die Klimakrise oder eine ungesunde Lebensweise besser lösen.
In Politik und Teilen der Medien waren diese Thesen beliebt, weil sie polarisieren und sich gut erzählen lassen. Ein Großteil der Ökonomen war allerdings immer skeptisch. Und nun bekommen sie durch eine Analyse der beiden Wissenschaftler Ivan Savin und Jeroen van den Bergh Unterstützung. Die beiden Studienautoren kommen nämlich zu einem vernichtenden Urteil: Fast 90 Prozent ihrer 561 untersuchten Degrowth-Studien sind in der Realität keine unabhängige Studien, sondern Meinungsbeiträge. Sie seien also keine Wissenschaft, sondern persönliche Wunschzettel. Deutlicher kann eine Kritik wohl kaum ausfallen.
Fast 90 Prozent eher Meinung als Analyse
„Die große Mehrheit, fast 90 Prozent, geben eher Meinungen als Analysen wieder“, schreiben Savin und van den Bergh in ihrer Zusammenfassung. „Degrowth kann (noch) nicht als bedeutendes akademisches Forschungsgebiet angesehen werden.“ So würden in der überwiegenden Zahl der Arbeiten weder belastbare Daten noch theoretisch fundierte Modelle angeführt. Und wenn mit Zahlen gearbeitet werde, dann seien die Stichproben nur sehr klein und nicht-repräsentativ. So seien für eine Studie über italienische Landwirtschaftsgenossenschaften beispielsweise 41 Interviews mit Mitgliedern aus drei Genossenschaften geführt worden – es gab zu diesem Zeitpunkt aber 430 solcher Genossenschaften in Italien. Für eine qualitative Erhebung sei das vielleicht nützlich, so die Studienautoren, die Repräsentativität müsse man jedoch hinterfragen.
Generell beurteilen die Ökonomen das wissenschaftliche Niveau fast durchgängig als unzureichend. Insbesondere in puncto Umsetzbarkeit. „Die meisten Studien bieten Ad-hoc- und subjektive politische Beratung, ohne politische Bewertung und Integration“, heißt es in der Studie. „Diejenigen Studien, die öffentliche Unterstützung untersuchen, kommen in der Mehrheit zum Ergebnis, das Degrowth nur wenig Zustimmung bekommt.“ Für die Datenanalyse vergeben Savin und van den Bergh daher nur die Note 5.
Großer Teil der Degrowth-Studien kommt aus Deutschland
Offenbar heißt es bei Degrowth-Studien „Quantität vor Qualität“, denn in den vergangenen Jahren hat die Veröffentlichungsdichte in diesem Themengebiet stark zugenommen. Deutschland gehört mit Spanien und Großbritannien zu den Top-3-Ländern, aus denen die mit Abstand meisten Studien stammen.
Die Degrowth-Autoren nehmen dabei keinesfalls für sich in Anspruch, die herkömmliche ökonomische Methoden zu verwenden. Ihrer Meinung nach versprechen auch marxistische, feministische oder wirtschaftsethische Ansätze ökonomischen Erkenntnisgewinn. Diesen Punkt kritisieren Savin und van den Bergh nicht einmal. Die Ergebnisse seien sogar logisch, weil es kaum belastbare Daten hierzu gebe, und es somit zu Verrungen komme – beziehungsweise im Endergebnis: Postwachstumsideen.
Viel Verständnis für diese Art des „wissenschaftlichen Arbeitens“ haben sie nicht. Denn die Postwachstums-Forscher stellen gerne weitreichende politischen Forderungen wie zum Beispiel einen Konsumverzicht. Die Umsetzbarkeit ihrer Ideen und Forderungen thematisieren sie aber kaum. Die „politische Machbarkeit“ dieser Fragen wird der Analyse zufolge nur in 0,7 Prozent der Studien behandelt.